
Hauptinhalt
Felix Salten über Karl Lueger
Trump? Lueger!
„Wollen wir ihn zur Abwechslung nicht einmal ganz ruhig betrachten? Mitten in dem besinnungslosen Tumult, der von ihm ausgeht und rückflutend beständig ihn umstürmt, so recht gelassen und besonnen. Das müsste doch möglich sein, gerade heute. Wenn er einem aber unter den Händen doch wieder Feuer fängt, lassen sich ja, gerade heute, ein paar Duschen zur Hilfe nehmen, die keinem von uns erspart bleiben: Schwelle des Greisenalters … Sonnenuntergang … vita somnium … sechzig Jahre. „Soweit im Leben ist zu nah am Tod,“ schrieb der altliberale Friedrich Hebbel. Und „Menschen, Menschen, san m’r alle,“ dudelt das Weltanschauungscouplet der Lueger-Epoche.
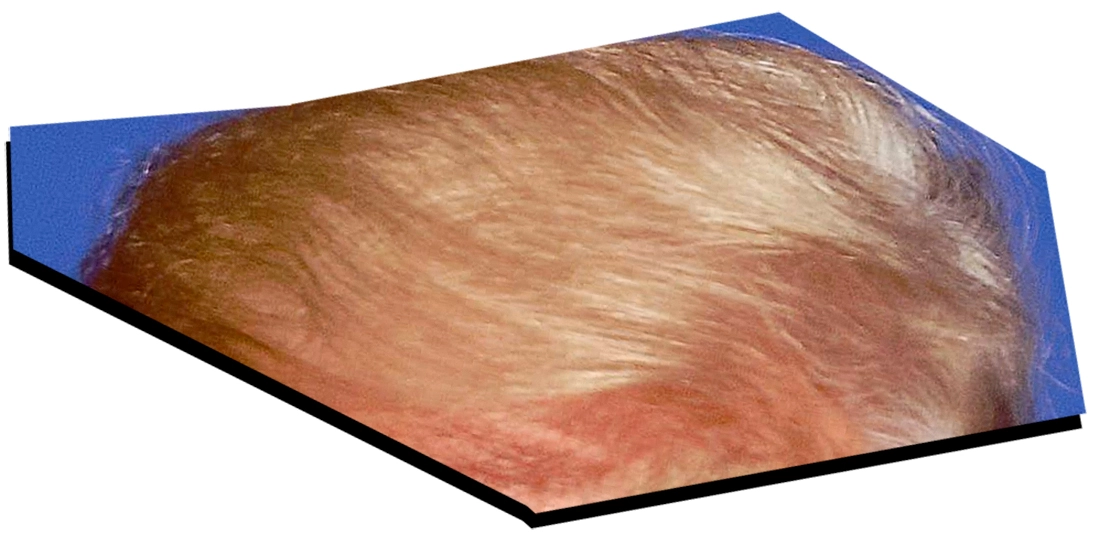
Es lässt sich nicht leugnen, dass er eine glänzende Bühnenerscheinung besitzt. Die beste, die es für sein Rollenfach gibt. Hochgewachsen, breitschulterig, nicht dick, aber doch behaglich genug und man wird das Wort „stattlich“ kaum vermeiden, wenn man ihn schildern will. Wie der Hauptakteur unter den Statisten stets herauszufinden ist, so fällt auch er immer auf, wenn er inmitten seiner Komparsen sich zeigt. Weithin sichtbar, wäre als besserer Ausdruck für ihn zu empfehlen. Nimmt man sein Antlitz noch dazu, dann wird vieles begreiflich. Für ein Wesen, das so ganz auf Äußerlichkeit gestellt ist, gilt solch ein Äußeres schon als Talent, als Prädestination, als Beruf, als Erfolgsbürgschaft. Die halbe Karriere. Dieses Gesicht wirkt vollkommen bieder. Einfache, aus knapper Stirn zurückfallende Haare, die sanft gelockt sind, kleine, vergnügt und schwärmerisch, naiv und sentimental wirkende Augen, ein außerordentlich solider Vollbart, der am Kinn nach dem Geschmack der Vororte geteilt ist. Und mitten in diesem würdigen, bürgerlichen, ruhigen Antlitz die nette, kleine Nase. Diese Nase, die wie eine aus der Bubenzeit stehengebliebene Keckheit aussieht: man kann es gar nicht anders sagen: bieder, rechtschaffen, treuherzig und wacker, lauter solche Worte fallen einem ein, wenn man sein Gesicht erblickt. Aus der Ferne. Es muss nämlich bemerkt werden, dass alle Wirkung dieser Physiognomie völlig bühnenmäßig auf die Distanz berechnet ist. In der Nähe redet dann schon eine trotzige Rauflust, die nicht ohne Tücke ist, von dieser schmalen Stirn. In der Nähe zeigt sich der seltsame Doppelblick dieser kleinen, listigen Augen, aus denen eine hurtige Verschlagenheit blitzschnelle blinzelnde Umschau hält. Da zeigt sich, vom soliden wackeren Bart verborgen, ein spöttischer Mund, der hinter der Ehrlichkeit grauer Haare schadenfroh zu lächeln vermag. In der Nähe erst wird der Schimmer von Schlauheit sichtbar, der dies Antlitz überbreitet, das auf Ansichtskarten schön ist. Eine heitere, ihrer Wirkung sichere, ihren Erfolg stets bewachende, eine taghelle Schlauheit, wie selten eine in einem männlichen Antlitz geschrieben stand.
Diese vollendet gute Maske, die auf zwei Schritte freilich einen anderen Charakter, aber doch immer noch einen Charakter trefflich zeichnet, muss auf die Galerie ebenso wirken wie auf das vornehme Parkett. Und auf das Parkett ebenso wie auf die Hofloge. Genauso malt sich der Volksgeschmack seine Führer, gehüllt in eine Salonrockeleganz, die der populären Pracht eines Advokaten vergleichbar ist, mit einer Würde der Gebärde, darin aber noch ein vertrauter Dialekt erkennbar bleibt. Aber er ist den kleinen Leuten trotzdem so weit gar nicht entrückt, dass er nicht den Prunk der edlen Gebärde abwerfen könnte, um plötzlich wieder ganz urwüchsig dazustehen, sieghaft, hemdärmelig, wie nur der geringsten einer: Menschen, Menschen san m’r alle. Er ist genau so, wie die vornehmen Leute den Mann des Volkes sich ausdenken, wobei sie dann auf einmal ängstlich sich besinnen, dass die doch eigentlich nicht genau wissen, wie das „Volk“ ist. Und er entspricht ganz dem Bilde, das seit jeher in den Fürstenschlössern vom Demagogen, vom Untertanenführer als Prinzenschreck gezeichnet ward. Die Figur ist primitiv ersonnen, wie der Arlecchino in der commedia dell'arte, das ist freilich wahr, aber man braucht ihr nur völlig zu gleichen, um sie unvergleichlich zu spielen.
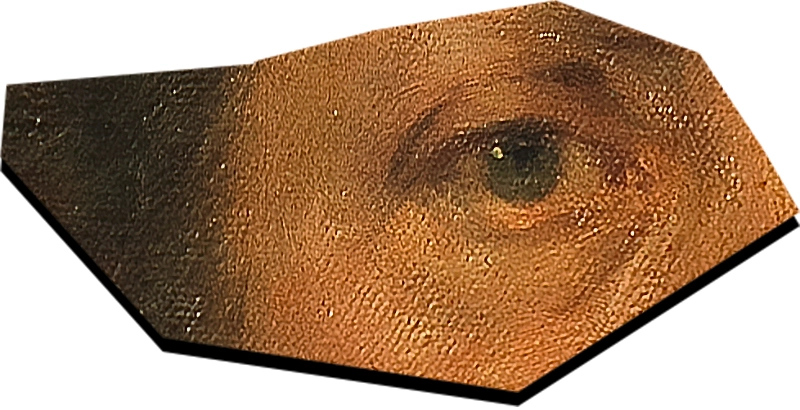
Gar manche versuchen es, möchten gern auch so applaudiert werden, aber es macht’s ihm keiner nach. Solange schon beherrscht er die Vielen und die Wenigen, überrumpelt mit seinem Temperament die Versammlungen, bezwingt die Parlamente, erobert die Straße und weiß die Widerstrebenden im Zwiegespräch einzeln zu kirren. Wie sein Gesicht, ist seine öffentliche Rede nur auf Distanz berechnet. Sie ist wie ein prächtiger Tapetenstoff, mit dem der Dekorationsmaler das Parterre blendet. Tritt näher hinzu, dann weist sich dir ein dürftiger Lappen mit großen plumpen Flecken abscheulich bekleckst, alles nur so hingeschmissen, auf die freche, grelle Augenblickswirkung hingehudelt. Aber gerade das trifft er. Das hat er nur so im Handgelenk. Solche Tapeten rollt er vor der Menge auf, in allen Farben brüllend und tobend, gleißend und schillernd, dass den Leuten die Augen übergehen. Ist diese Gabe der Faszination zu unterschätzen? Man muss ihn hören, wie sein fröhlicher wienerischer Dialekt sich nach und nach immer feierlicher und feierlicher aufrichtet, zu einem Hochdeutsch, in dessen reinstem Vollton Vater noch wie „Vatter“ klingt. Wie er dann pathetisch wird, aber mit einem Pathos, in dessen donnernder Orgel doch immer eine leise Ironie deutlich tremoliert, ein Pathos, das in der eigenen Wucht sich übermütig schaukelt und seine eigene herzinnige Falschheit herzinnig belächelt, ein Pathos, das dem Pathetischen eigentlich Feind ist, es gering achtet und immer zu sagen scheint: „Da seht ihr, wie leicht, wie spottbillig der ganze Lärm anzurichten ist!“ Ein echt wienerisches Pathos, das mit diebischem Vergnügen schon den Augenblick erwartet, in dem es – wie es sich kennt – umschnappen wird ins Gemütliche. Und es schnappt um. Aus der heroischen Arie in den Gassenhauer. Hat er seine Zuhörer hart bis an die Pforte des Burgtheaters geführt, dann schleudert er sie lachend mit einem Fußtritt plötzlich weit ins Lerchenfelderische zurück, oder auf den Naschmarkt, dass sie wonnekreischend, ob solcher Kurzweil entzückt, unter den Obstkörben und Kraftworten der Standelweiber durcheinanderpurzeln.

Es fällt ihm gar nicht ein, wirklich höher zu steigen als sein Auditorium, seine Zuhörer zu einem Aufschwung zu nötigen, ihnen die Mühe zu bereiten, dass sie über sich selbst hinaus müssen. Er bleibt dicht in ihrer Nähe. Sie mögen noch so tief stehen, er stürzt sich zu ihnen hinunter – den Hals kann’s ja nicht kosten – und nie gähnt eine Kluft zwischen ihm und ihnen. Beinahe genial ist es, wie er seine Argumente sich zusammenholt. Gleich einem Manne, der in Rage nach dem Nächsten greift, nach einem Zaunstecken, Zündstein, Briefbeschwerer, um loszudreschen, greift er, um dreinzuschmettern, nach Schlagworten aus vergangenen Zeiten und bläst ihnen mit dem heißen Dampf seines Atems neue Jugend ein, rafft weggeworfenen Gedankenkehricht zusammen, bückt sich nach müd am Weg niedergebrochenen Banalitäten, peitscht sie auf, dass sie im Blitzlicht seiner Leidenschaft mit dem alarmierenden Glanz des Niegehörten wirken. In dem rasenden Anlauf, dessen sein Temperament fähig ist, überrennt er Vernunftgründe und Beweise, stampft Bedeutendes wie kleine Hindernisse in den Boden, schleudert dann wieder mit einem Wurf Nichtigkeiten so rasch empor, dass sie wie die höchsten Gipfel der Dinge erscheinen. Im Furor seiner Rednerstunde gerät der Mutterwitz, der sein Wesen durchdringt, ins Sieden und wirft Blasen, in denen alles wie toll, alles verkehrt und lächerlich erscheint. Einfälle sprudeln hervor, in deren Wirbel frappierende, unglaubliche und verführerische Gedanken funkeln, sich drehen und überschlagen. In seinen Rednerfuror, wenn ihm schon alles egal ist, fängt er freilich auch den Schimpf der Straße ein, reißt den Niederen und Geistesarmen alberne Sprüche des Aberglaubens vom Munde, schnappt selbst den Pfaffen die Effekte weg, die auf der Kanzel längst versagen wollten – aber er siegt mit alledem. Schlägt zu damit und trifft und wirkt. Oft schon hat er die Philister unseres Parlaments vor sich hergejagt – wie sich nachher gezeigt hat – mit einem Eselskinnbacken.

Des Rätsels Lösung? Die volle, überlegene, wirkliche Persönlichkeit, die immer, ein Samson an Kraft, gegen die Dutzendmenschen steht. Dieses ist seine Macht über das Volk von Wien: dass alle Typen dieses Volkes aus seinem Munde sprechen, der Fiaker und der Vereinsobmann, der Schusterbub und der gute Advokat, die Frau Sopherl und der Armenvater. Und alle Volkssänger mit dazu. Vom Guschelbauer an bis zum Schnitter. Man hört die Schrammelmusik aus der Melodie seines Wortes, das picksüße Hölzel und die Winsel, hört das Händepaschen, und ein jauchzendes Estam-Tam klingt in seiner Stimme beständig an. Das gute Mundwerk der Österreicher hat in ihm seine höchste Vollendung gefunden.
Aber lauscht man noch tiefer in seine Rede hinein, dann vernimmt man den rasenden Galopp seines Ehrgeizes, der mit wildem Hufschlag über alles hinwegsprengt, rücksichtslos, alles niederreitet, dem alles gleich ist, der keine andere Last mit sich forttragen will als die eigene, den außer das eigene Selbst nichts ernst, nichts bestehend, nichts wichtig dünkt und der diesem Manne das hinreißende Tempo gibt.
Das ist – und wenn er auch die besten Pläne um die Erde hauen muss – nur ein Ziel:
Wirken! Wirken! Wirken!
Da ist nur ein Wollen – und hilft auch das Schlimmste dazu:

Immer und immer buhlt er, wirbt er um den Erfolg, leidenschaftlich, inbrünstig, vor der Menge ebenso wie vor dem einzelnen. Und seine gelenkige, in allen Übungen der Menschenjagt ausgelernte Intelligenz versteht sehr genau zu unterscheiden. Er ist nicht so geschmacklos, die Rednerpose, die für den großen Saal nur sich eignet, auch im Zimmer zu behalten. Er ist klug genug, den anderen deutlich für klug zu nehmen und ihn unter vier Augen anders, seiner zu bedienen. Man ist hinter den Kulissen und kann leiser sprechen, die Aufregung der Arena braucht hier nicht fortgesetzt zu werden, nicht die Feindseligkeit und nicht die Karesse. Ein humoristisches Achselzucken, und der andere weiß: „aber Freunderl…“ Ein Listig-ironisches Blinzeln dieser kleinen Augen, und der ganze Tross von Choristen, mit dem er auftritt, ist abgeschüttelt. So fängt er die Wenigen, die der Versammlungspsyche nicht erliegen, in der Amtsstube, in den Couloirs, an der Bankettiertafel, wirft ihnen das Lasso seiner Aufrichtigkeit, seines gemütlichen Verstehens über, ein Dompteur und Plauderer, ein Menschenfänger und ein ewiger Gewinner im Spiel des Lebens. Die Jahre des Kampfes sind jetzt für ihn vorüber, vorbei die Tage, in denen er den Plan seines Angriffes bewundern ließ, die Verve seiner Unzufriedenheit, die aufwühlende Gewalt des Machtlosen. Er ist Bürgermeister, ein unbegreiflich kleines Ziel für so großen Ehrgeiz, sollte man glauben. Aber man muss sagen: Er hat etwas aus seiner Rolle gemacht, erstaunlich viel. Wie Mitterwurzer einst, als er in „Don Carlos“ den Philipp gab, das Stück umgekehrte und alle Welt zur Verwunderung zwang. Gegen Carlos und Posa war dieser Philipp nie aufgekommen, er galt für so wichtig nicht, nicht für so begehrenswert und dankbar. Und jetzt auf einmal war Philipp die Hauptsache, war Mittelpunkt und Held des Stückes. Die vorigen Bürgermeister sind nur brave Ensemblespieler gewesen gegen den jetzigen. Der aber schwang sich wieder zum Star empor. Die Kunst der Auffassung. So wie er diese Rolle anschaut, wie er die Bedeutung dieses Amtes auffasst, hat er es ganz neu entdeckt: fast möchte man sagen, neu kreiert. Man sieht jetzt, was der Bürgermeister vorstellt, hier in der Residenz, wo Patriotismus und die Loyalität am meisten erwünscht, aufs ängstliche gehätschelt sind. Er hat sich ganz einfach neben den anderen Herren zum Herrn in Österreich gemacht: indem er das „Gott erhalte“ in städtische Regie nahm. Wollen wir ihn heute ganz ruhig betrachten?

Wie man ein seltenes Menschenexemplar besieht, als einen ungewöhnlichen Mann, der durch die enorme Triebkraft seines Wesens, durch die außerordentliche Energie seiner Art so hoch gestiegen ist: ihn abseits von allen Meinungen, die uns teuer sind, anschauen, abseits auch von allem Tun, das uns verwerflich dünkt. Wir haben stets den großen Schauspieler begriffen, wenn er Iffland und Blumenthal und noch Schlimmere spielte, um der guten Rolle willen, um seiner Natur zu gehorchen, die ihn beständig auf die Szene jagt und nicht duldet, dass er in der zweiten Reihe steht. Auch ihm können wir auf dem gleichen Weg verstehen. Er spielt das Zugstück, das eben auf dem Repertoire steht. Und er spielt es mit einer so fabelhaften Bravour, spielt es mit einem jugendlichen Feuer, dass man dabei vergisst, wie lange dieser Mann ungeduldig und im Halbdunkel auf sein Stichwort warten musste. Der Wert seiner Rolle mag widerwärtig sein, das Gefallen, das die Leute an ihm finden, von vernichtender Schädlichkeit. Das mindert, wenn man sie absolut betrachtet, seine Begabung nicht. Er spielt seine Rolle als wirklicher Künstler unter Dilettanten. Und es ist viel Rollenneid rings um ihn her. Um ganz aufrichtig zu sein, muss man auch das sagen. Er aber hat nie etwas anderes gewollt, als in dem Stücke, das Erfolg hat, die Hauptrolle spielen, gleichviel, ob es modern oder veraltet ist, gleichviel, ob es roh oder kunstvoll wirkt, wenn es nur gefällt, wenn es nur Zulauf hat. Und die Komödie, die heute unter nicht enden wollendem Beifall bei uns aufgeführt wird, ist offenbar sehr nach dem Geschmack der Menge. Wir haben schließlich das Theater, das wir verdienen. Man müsste das Publikum schmähen, aber das wäre vergeblich und ungerecht. Man müsste eher die Direktoren angreifen, die das Volk zu solcher Lust seit Jahrhunderten erzogen haben, aber das darf man wieder nicht. Kann sein, die Posse hält sich nur so lange, weil der erste Darsteller so beliebt ist. Kann sein, das Stück wird wieder abgesetzt, wenn der Träger der Hauptrolle, der ja heute schon sechzig Jahre zählt, einmal nicht mehr da ist. Einstweilen aber muss man sagen, dass er noch vortrefflich im Zug scheint, und das Schauspiel, das sein Talent uns bietet, lohnt die Mühe des Zusehens. Es ist ganz einzig, wie er die Art des Landes interpretiert, wie viele Aufschlüsse über Österreich er täglich gibt, er, der seinen Doktorhut mit Rekrutensträußen und Wallfahrtsbildern besteckt und ihn schief aufsetzt, wie nur der Bratfisch seinen Schmalranftler.
Es haben in unserem theaterenthusiastischen Wien schon viele schlechtere Mimen ihr Jubiläum gefeiert, sind beklatscht und mit Lorbeer überschüttet worden. Mag denn auch dieser Liebling jubilieren. Er hat’s verdient wie selten einer. Er hat sein Publikum durchgeschüttelt, in Atem gehalten, in Aufruhr versetzt, aber nie gelangweilt. Er hat seine Leute das Fluchen wie das Beten gelehrt, je nachdem es im passte. Mehr kann man nicht verlangen. Wem aber der festliche Taumel heute vielleicht zu arg erscheint, der mag sich beschwichtigen: Auch Diesem flicht die Nachwelt keine Kränze!“
Die Ausstellung „Im Schatten von Bambi. Felix Salten entdeckt die Wiener Moderne“ ist von 15. Oktober 2020 bis 25. April 2021 im Wien Museum MUSA und in der Wienbibliothek im Rathaus zu sehen.




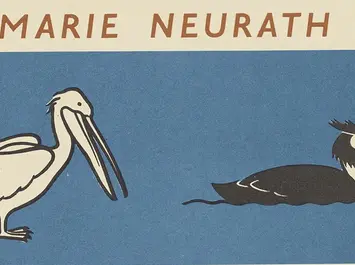
Kommentar schreiben
Kommentar schreiben
Kommentare
Der Artikel ist großartig und interessant. Aber der Vergleich mit Trump ist genau so dümmlich wie Trump selbst.