Beiträge zum Thema Hygiene
Hauptinhalt

Hundemarke der Gemeinde Wien, 1890, Wien Museum: Inv.-Nr. 308465/32
Einführung der Hundesteuer in Wien
„...dass wir eigentlich von unseren Hunden leben!“
Ehe in Wien 1869 zum ersten Mal eine „Gemeindeauflage auf den Besitz von Hunden“ in Kraft trat, waren herumstreunende Straßenhunde keine Seltenheit im Stadtbild. Erhoffter Nebeneffekt dieser Steuer war die Eindämmung der Tollwut.

Catalog von Marianne Bendl, K.U.K. Priv. Busenschützer-Fabrik Wien, 1893, Rückseite, Universitätsbibliothek der Universität Wien
Marianne Bendl und ihr Reform-BH
„...das Mieder ist der Feind der Gesundheit des Weibes“
Das Korsett war lange Zeit ein Must-have der Damenmode. Dem setzte sich erstmals eine in Wien ansässige Kleidermacherin und Unternehmerin entgegen: Marianne Bendl brachte den „Busenschützer“ auf den Markt und versuchte die Damenwelt so von ihrer Einschnürung zu befreien - nicht ohne gehörige Kontroversen auszulösen.
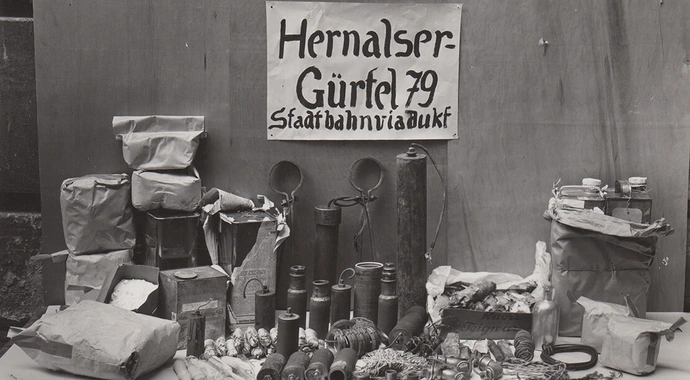
Sprengmittel der Nationalsozialisten, die am Hernalser Gürtel aufgefunden wurden. Foto: Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes (DÖW)
Die Kanalbrigade der SA
Terror im Untergrund
Nachdem Engelbert Dollfuß im März 1933 das Parlament ausgeschaltet hatte, entmachtete er sukzessive die Arbeiterschaft und ihren politischen Einfluss. Im Widerstand gegen das austrofaschistische Regime plante der Republikanische Schutzbund – als militärischer Arm der Sozialdemokraten – unter anderem auch, Sprengstoffanschläge aus der Kanalisation heraus durchzuführen. Dies wiederum erregte das Interesse der nationalsozialistischen Sturmabteilung (SA).

Männer der Kanalbrigade im Kontrolleinsatz, 1935, Foto: Fritz Zvacek / ÖNB-Bildarchiv / picturedesk.com
Die Wiener Kanalbrigade
Sicherheit im Untergrund
Als 1925 und 1926 die Zahl der Einbrüche in Wien zunahm, reagierte die Wiener Polizei zunächst mit verstärkten Streifengängen. Einige Kriminelle nützten daraufhin das Kanalsystem für ihre Machenschaften – nun war wieder die Polizei am Zug.

Elin-Staubsauger, um 1950, Wien Museum, Inv.-Nr. 239723/17, Foto: TimTom
Geschichte des Staubsaugers
Mit Vampyren und Kobolden auf Bakterienjagd
Wohnungsreinigung oder Frühjahrsputz ohne Staubsauger? Lieber nicht, werden die meisten denken. Kaum jemand verzichtet heute auf so ein Gerät, es zählt zu den verbreitetsten Alltagsgegenständen. Seine Karriere begann vor gut 120 Jahren, in einer Zeit, in der vor allem in den großen Städten ein erbitterter Krieg gegen den Staub geführt wurde.

Josef Mutterer: Die Alserbachstrasse während der Regulierung, um 1875, Wien Museum
Einwölbung der Bäche und Flüsse von Wien
Die speziellen Alserbachforellen
Bis ins 19. Jahrhundert rauschten Bäche aus dem Wienerwald in offenen Betten durch die Stadt. Ihr Wasser trieb die Räder der Mühlen an, sie dienten der Reinigung, spülten Unrat hinweg und veranlassten Künstler zu romantischen Kompositionen. Aus hygienischen Gründen und um Überschwemmungen zu vermeiden, wölbte das Stadtbauamt die Bäche und Flüsse ein.

Ausstellungsansicht zum Thema Körperbilder, Foto: Reiner Riedler
Zur Wiedereröffnung des Josephinums
Geschichte geht durch den Magen
Nach vierjähriger Schließzeit präsentiert sich das Josephinum nicht nur baulich runderneuert, sondern mit einer Dauerausstellung, die Medizingeschichte unter unterschiedlichsten gesellschaftlichen Aspekten beleuchtet.

Innenansicht des Tröpferlbades in der Ratschkygasse 26 im 12. Bezirk, um 1926, Wien Museum
Die Geschichte des Tröpferlbades
Körperhygiene für alle
Tröpferlbäder bezeichnen in Wien öffentliche Brausebäder, in denen sich Menschen gegen ein geringes Entgelt oder sogar kostenfrei duschen können. Rund hundert Jahre zählten sie flächendeckend zum fixen Inventar in der Stadt.

Innenansicht des Tröpferlbades, Duschraum Herren, 2021, Foto: Klaus Pichler, Wien Museum
Bezirksmuseum Wieden
Auf den Spuren des Tröpferlbades
Das Gebäude des heutigen Bezirksmuseums Wieden wurde 1893 als Städtisches Volksbad – Wienerisch „Tröpferlbad“ – errichtet. Als solches war es fast 100 Jahre in Funktion. Im Zuge der Arbeiten zu einer neuen Dauerausstellung wurden die Geschichte des Hauses sowie dessen spezifische Architektur genauer unter die Lupe genommen.

Schild aus dem ehemaligen Beatrixbad, fotografiert von Thomas Keplinger anlässlich einer Begehung vor der Renovierung des Hauses, 2010
Beatrixbad
„Mit der größten Bequemlichkeit ausgestattet“
Die wenigsten der Bäder, die vor 1900 erbaut wurden, sind noch in ihrer ursprünglichen Substanz erhalten geblieben. Deshalb war es ein besonderer Glücksfall, als 2010 die Reste des einstigen Beatrixbads kurzfristig „auftauchten“. Zur Geschichte einer Wiener Institution.