
Porträts von Vera Ferra-Mikura, um 1950, Archiv Mikura, Repro: Victoria Nazarova
Hauptinhalt
Über Vera Ferra-Mikura und ihren Nachkriegsroman „Die Sackgasse“
Die Möglichkeit des Gelingens
Eine wichtige und oft unterschätzte Grundlage für das literarische Schreiben ist der Selbstzweifel. Denn Schreiben heißt, etwas Ungeformtes, Unförmiges in Sprache zu übersetzen und ihm damit eine Form zu geben. Das heißt aber auch, dass die Vorstellung von einer Geschichte, von Figuren, von einem Rhythmus, von der Unordnung, die man im Kopf hat, sich nicht mit dem Text auf dem Papier deckt. Schreibend kann man sich dem sich in alle Richtungen fließenden Denken nur annähern. Das, schrieb Vera Ferra-Mikura einmal, sei das eigentliche Anliegen ihres Schreibens, egal, ob es sich um Kinderbücher oder Literatur für Erwachsene handle: dieses Zusammenführen von Innen und Außen. „Darin liegt eine freudige Spannung für mich, ein wechselvolles Abenteuer, die Lust am Experiment.“
Diese Lust zeigt sich schon früh. In ihren ersten Büchern legt sie eine große formale wie inhaltliche Bandbreite an den Tag: 1946 erscheinen der Gedichtband „Melodie am Morgen“ und die Kinderbücher „Der Märchenwebstuhl“ und „Der Käferspiegel“, 1947 folgt ihr erster Roman „Die Sackgasse“. Alle noch unter dem Namen Vera Ferra. Die Erweiterung zum Doppelnamen erfolgt 1948 nach der Heirat mit dem Staatsoperntänzer Ludwig Mikura. Es scheint, als wolle eine junge Autorin unterschiedliche Formen und Genres ausprobieren, um herauszufinden, welches „wechselvolle Abenteuer“ ihr am ehesten zusagt. Schriftstellerische Anfänge sind auch Gehversuche, ein Tasten nach einem sicheren Grund, auf dem man nicht unbedingt verharren möchte, der einem aber doch das Nachdenken darüber ermöglicht, in welche Richtung man sich weiterbewegen möchte, welche Mittel man besser oder weniger gut beherrscht, welche Themen und Formen von innen nach außen drängen und - nicht zuletzt - wie die Texte aufgenommen werden, von der Kritik, vom Publikum.

Für Vera Ferra ist die Richtungsfrage 1946/47 völlig offen, nicht nur, weil sie die Grenze zwischen Kinder- und Erwachsenenliteratur nicht ziehen will und sie sich in der Lyrik genauso sicher fühlt wie in der Prosa, sondern auch durch die positive Resonanz, die ihr beziehungsweise ihren vier Büchern widerfährt. 1946 publiziert Otto Basil in der von ihm herausgegebenen Zeitschrift „Der Plan“ Gedichte der 23jährigen aus dem Band „Melodie am Morgen“, der, wie ein Kritiker urteilt, eine Persönlichkeit zeige, die bereits mit innerer Sicherheit ihre Erlebnisse mit großer Intensität aussprechen könne. Diese Gedichte aus den Jahren 1941 bis 1945 sind geprägt vom Blick auf soziale Verhältnisse und vom Krieg weniger als Gewalterfahrung, sondern vielmehr als Gewissheit, um die Jugend betrogen worden zu sein.
Hoffnungsvolles Erwachen
Auch für Vera Ferras Lyrik gilt, was ihre Zeitgenossin Erika Danneberg über die junge Schriftstellergeneration nach 1945 schrieb: „Von daher erklärt sich das Überangebot an Traumbildern und die Ambivalenz des Erwachens, das keineswegs nur als Glück, sondern auch als schreckhaft und als Bedrohung der Identität in den Versen in Erscheinung tritt. Darum ist das Träumen, als regressives Moment, jenseits der vordergründigen Aussagen im einzelnen Gedicht so verbreitet und das Erwachen so schwer.“ Ferras Blick auf die Wirklichkeit ist in der Tat einem Erwachen geschuldet, einem Zustand also, in dem sich die gerade durchlebte Nacht, die Dunkelheit, die bösen Träume, die Angst überlagern mit der Helligkeit, der Hoffnung, der Freude auch, etwas überstanden zu haben und der Lust, sich auf etwas Neues, Besseres einzulassen. Ihr Blick ist kein pessimistischer wie etwa jener von Ilse Aichinger, die ebenfalls zu jener Zeit im „Plan“ erste Texte veröffentlicht und 1948 mit dem Roman „Die größere Hoffnung“ debütiert. „Ein unklarer oder negativer Schluss hinterlässt Mutlosigkeit“, sagt Ferra einmal, „nicht einmal der erwachsene Mensch, der stärker ist als das Kind, kommt ohne Illusionen aus“. Dabei darf man nicht außer Acht lassen, dass Ilse Aichinger als Halbjüdin und ihre Mutter als Jüdin den Holocaust in Wien mit knapper Not überlebten. Ihre Schwester Helga gelangte mit einem Kindertransport nach England, die Großmutter und die jüngeren Schwestern der Mutter wurden im Vernichtungslager Maly Trostinez ermordet.
Man könnte sagen, dass sich in der jungen Literatur der unmittelbaren Nachkriegszeit zwei Haltungen manifestieren: die Möglichkeit des Scheiterns (Ilse Aichinger, Ingeborg Bachmann, Marlen Haushofer, Hertha Kräftner, Gerhard Fritsch) und die Möglichkeit des Gelingens (Vera Ferra-Mikura, Friederike Mayröcker, Andreas Okopenko).
Die beiden ebenfalls 1946 erschienenen Kinderbücher muten auf den ersten Blick an wie Gegenentwürfe zur Trümmerwirklichkeit der ersten Nachkriegsmonate. Es ist zu jener Zeit nicht ungewöhnlich, das gerade erst Erlebte literarisch in Traumbilder zu verwandeln, mythische oder märchenhafte Szenerien zu entwerfen und das Augenscheinliche, die Toten, die Not und die Zerstörung, gerade nicht zur Sprache zu bringen. „Schuldlos möchten wir sein“, heißt es in einem Gedicht von Vera Ferra, wobei das „Wir“ als Abgrenzung zur Elterngeneration gemeint ist, die durchaus Schuld auf sich geladen hat. Diejenigen allerdings, die als Kinder und Jugendliche in diese Schuld hineingewachsen sind, die keine Wahl hatten, die nicht nach ihren Wünschen gefragt, sondern indoktriniert und systemkonform gemacht wurden, wollen nicht nachträglich verantwortlich gemacht werden für die Folgen dieser Schuld. Dennoch lockt Ferra ihr junges Publikum nicht ins zeitentrückte Nirgendwo. Sie vermeidet in „Der Märchenwebstuhl“ und „Der Käferspiegel“ den Rückgriff auf bewährte Märchenmuster mit eindeutigen Zuordnungen von Gut und Böse. Es gibt keine Hexen, Feen und Zwerge, sondern Menschen, Tiere und Blumen im Kontext einer komplexeren Gesellschaftsordnung, die, und das ist wesentlich, nicht vorbestimmt oder den Individuen aufgezwungen wurde, sondern sich aus deren Verhalten und Entscheidungen ableitet.
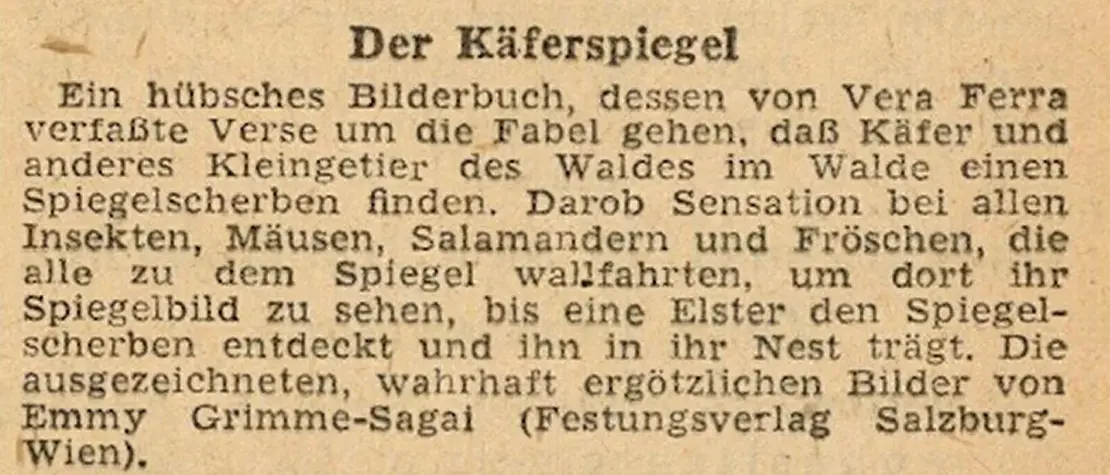
1947 schließlich erscheint „Die Sackgasse“, der erste Roman der 24jährigen Autorin – und zugleich eine Zäsur in ihrem Werk. Es scheint, als habe sie den sicheren Grund gefunden. Und doch wird sie ihn verlassen.
Nicht zuletzt deshalb, weil junge Autorinnen und Autoren in einem schwer überschaubaren, ideologisch und inhaltlich verschwommenen, kurzlebigen, mitunter wenig ambitionierten, launischen und männlich dominierten Umfeld um die Chance kämpfen müssen, überhaupt in Erscheinung zu treten. Das ist eines der zentralen Themen in „Die Sackgasse“; Rupert Kleist möchte Schriftsteller werden, aber er weiß nicht wie. Er weiß zwar, was er schreiben möchte, Form und Inhalt stehen ihm recht klar vor Augen, doch wie er damit eine Öffentlichkeit erreicht, wie aus dem Wollen ein Sein, also eine Lebensgrundlage, werden kann, ist ihm ein Rätsel. Einerseits spielt dabei das soziale Umfeld eine Rolle, denn eingebettet in ein Klima aus Interesselosigkeit an kreativer Begabung, da von den Erwachsenen an deren ökonomischer Verwertbarkeit gezweifelt wird, gedeiht keine Selbstsicherheit. Der Versuch, sich zu emanzipieren, wird immer begleitet vom Verdacht, die Anderen könnten doch Recht haben. Andererseits verfestigt sich der Selbstzweifel durch die Vielzahl an Türhütern, denen man, wenn man das literarische Feld dennoch betritt, begegnet. Wenn Rupert einen Text für die Zeitschrift „Mosaik“ schreibt, sitzt dort der Redakteur Milar: „Er hatte die Macht, er war mit dem Korrigierstift verwachsen“. Die Leser möchten sich entspannen, behauptet Milar, für phantastische Gedankensprünge seien sie zu schwerfällig. Der Versuch, Texte bei der „Parallele“ unterzubringen, von der der jugendliche Redakteur Artur Kalander meint, die Zeitschrift sei „Revolution, bedeutet frische Luft zwischen den Wolkenkratzern der Tradition, dem geistigen Antiquitätenladen unserer verstaubten Konkurrenz“, erweist sich als nicht minder problematisch, denn Kalander muss zugeben, dass die „Parallele“ erstens auf Abonnenten angewiesen ist und zweitens auf das Wohlwollen einflussreicher Kritiker. Ganz ohne Kompromisse wird es also nicht gehen.

Vera Ferra macht im Roman die Entstehungsbedingungen von Literatur zum Thema – die Bedingungen in den Jahren nach 1945, genau genommen, die geprägt sind von Netzwerken, politischen Seilschaften, paternalistischer Kulturpolitik, Ressentiments gegenüber dem Neuen und, aus weiblicher Sicht, von einer gewissen Abhärtung gegenüber Übergriffigkeiten. Um letzteres im Roman auszublenden, mag es sein, dass sie einen jungen Mann zum Protagonisten gemacht hat. Ihre Erfahrungen als junge Frau im Berufsleben und im Umgang mit Männern hat sie auf Ruperts Schwestern Fanny und Luise projiziert. Vera Ferra hat unter anderem als Laufmädchen in einem Wiener Warenhaus, als Stenotypistin in einem Architekturbüro und als Erntehelferin in einem Wachauer Weingut Erfahrungen gemacht, die sie in der „Sackgasse“ kenntnisreich verwertet.
Auch wenn der Roman autobiografisch grundiert ist, handelt es sich dabei in erster Linie um eine Geschichte von Emanzipationsversuchen verschiedener Repräsentanten einer bestimmten Generation, eben jener Generation der „schuldlosen“ Menschen Anfang, Mitte zwanzig, die hier allerdings eher eine „lost generation“ sind, Menschen in unerträglichen Abhängigkeitsverhältnissen, denen sie zu entkommen suchen. Viele Möglichkeiten gibt es nicht. Die jungen Männer im Roman versuchen sich Netzwerke aufzubauen oder sich in solchen zu integrieren, um mittels künstlerischer Tätigkeit den sozialen Status zu ändern. Interessanterweise ist ein Aufstieg durch Bildung, also ein Studium und eine anschließende akademische Berufslaufbahn kein Thema. Vermutlich ist diese Vorstellung von Emanzipation zu bürgerlich und zu wenig verbunden mit der Idee einer geistigen Erneuerung. Für die jungen Frauen, Ruperts Schwestern etwa, sieht die Angelegenheit schon trister aus. „Hätte ich dein Talent, ich fände aus dieser Sackkasse heraus, und die Welt ließe sich von mir wie ein Ball jonglieren“, ermahnt die lebenshungrige Luise ihren melancholischen, von Selbstzweifeln geplagten Bruder. „Du nimmst deine Begabung gelangweilt zur Kenntnis und nützt sie nicht aus. Ich möchte auch gern etwas Außergewöhnliches können - und bin auf irgendeine dumme Beschäftigung angewiesen.“ Oder auf eine Ehe. Die besonnene Fanny wird diesen Weg gehen, die emotionale Luise wird eine ohnehin zum Scheitern verurteilte Liebesbeziehung nicht überleben. Die Möglichkeit des Gelingens bietet sich nicht jeder und jedem und Rupert muss erkennen, dass das Streben nach Glück mitunter einen hohen Preis hat.
Auf Vera Ferra trifft beides zu. Sie heiratet 1948, bekommt zwei Kinder und hält sich für einige Zeit aus dem Literaturbetrieb heraus. Zumindest was das Schreiben betrifft. Sie ist aber auch eine eifrige Netzwerkerin, zeitlebens in formellen Vereinigungen und informellen Gruppen aktiv, sie lernt, mit männlichen Machtattitüden umzugehen und baut, wenn diese ihr zuviel werden, Parallelstrukturen auf - einen literarischen Salon etwa, nicht öffentlichkeitswirksam im Kaffeehaus wie Hans Weigel, sondern in der Privatwohnung Ferra - Mikura. Friedrich Polakovics, Redakteur der Zeitschrift „Neue Wege“ notiert am 2. Oktober 1950 in seinem Tagebuch: „Literarischer Abend bei Vera mit Busta, Kräftner, Ebner, Hauer, Diem, Altmann, Hradek, Gunert.“ Vor Mansplaining ist man dort sicher. Auch vor Selbstüberhöhung. Der Schriftstellerei haftet ihrer Ansicht nach nichts Heroisches an und es könnte genausogut aus Rupert Kleists Mund kommen, wenn sie sagt: „Einem Menschen, in dessen Personalausweis die Berufsbezeichnung Schriftsteller steht, wird allgemein ein Image angedichtet, das er in den wenigsten Fällen hat. In den Augen jener, die mit dem Schreiben von Weihnachtswünschen das Auslangen finden, schwebt der Schriftsteller in einer glitzernden Luftblase außerhalb der gewöhnlichen Atmosphäre. Dazu tragen oft auch die Filme bei, in deren Mittelpunkt der Schriftsteller, bekleidet mit einem exotischen Morgenrock, seiner Sekretärin geistreiche Sätze diktiert. Spitzwegs Gemälde, das den Dichter frierend in seiner Dachkammer zeigt, gibt der Armut des Poeten wiederum einen so romantischen Anstrich, dass sie weniger realistisch wirkt als die Armut Aschenputtels. Aber Mitleid für sich selber zu erwecken, ist ohnehin nicht die Aufgabe dessen, der schreibt. Sein Anliegen kann auch nicht sein, für das, was er tut, bewundert zu werden. Eitelkeit kann ihn sprachlos machen. Für einen Schriftsteller das ärgste Malheur. Über die Berufsbezeichnung Schriftsteller, der man hilflos gegenübersteht, werden noch Generationen grübeln müssen, falls sie nicht durch ein anderes Wort ersetzt wird. Aus Bequemlichkeit nimmt man es hin, ein Schriftsteller zu sein. Man stellt die Schrift, wie man Sessel um einen Tisch gruppiert, man stellt die Schrift als Segel in den Wind, man stellt sie wie einen Zaun, wie ein Verkehrszeichen oder einen Kleiderständer irgendwohin, man stellt sie wie einen Gartenzwerg zwischen Blumenbeete, wie einen Schirm in die Ecke, man stellt sie als Behauptung auf, man stellt sie zur Debatte, man stellt sie vor und um. Zuletzt, wenn man aufhört, ein Schriftsteller zu sein, stellt man die Schrift ab und das Schreiben ein.“

Für die jungen Autorinnen und Autoren ist es schwer, gegen die restaurative Kulturpolitik unmittelbar nach 1945 mit Texten in Erscheinung zu treten, die einen gewissen Eigensinn und Unbelastetheit an den Tag legen. Rupert Kleist ist auch in dieser Hinsicht Vera Ferras alter ego (beide sind gleich alt). Seine Versuche, in den Gedichten und Artikeln, die er seinem wichtigsten Abnehmer, dem Redakteur Milar unterbreitet, die Vergangenheit sprachlich und formal hinter sich zu lassen, stoßen bei diesem auf Ablehnung. „Sie dürfen nicht Ihre Energie an phantastische Projekte verschwenden und Ihren Hirngespinsten - verzeihen Sie den groben Ausdruck - Nahrung geben“, wird er ermahnt, um sich darauf auf eine Weise belehren zu lassen, die gedanklich fest in der lingua tertii imperii verwurzelt ist: „Denken Sie sich, Sie seien ein Baum mit gesunden Ästen, und diese Äste sollen Früchte tragen. Sie können es auch – aber da ist ein Ästchen, das hoffnungslos und unnütz ist. Es ist schwach und krank, entzieht aber dem Baum enorme Kräfte. Wenn Sie ein kluger Baum sind, werden Sie diesen schädlichen Ast dem Sturm entgegenhalten, damit er gebrochen wird. Ich möchte gern in Gestalt eines Gärtners an Sie herantreten und den bösen Ast einfach absägen (…)“ Mit großem Geschick legt Vera Ferra den unbewussten Gebrauch der Ideologie frei, die zumindest verbal nicht überwunden ist und die noch weit in die Zweite Republik hineinragt. Dazu gehört auch das gedankenlos hingeworfene „Jedem das Seine!“, das den inneren Kern des sich selbst als aufrechten Demokraten begreifenden Milar sichtbar macht. Und nicht nur seinen, sondern jenen der Generation, die eben nicht schuldlos ist. Dazu gehören auch die Bewohner des Hauses in der Sackgasse. Es sind ja nicht allein die beengten ökonomischen Verhältnisse, die deren Handlungsspielraum begrenzen. Vielmehr ist es - und da ist der Vergleich mit Elias Canetti, den ein zeitgenössischer Kritiker anstellt, nicht von der Hand zu weisen - die moralische Verkommenheit eines Kleinbürgertums, dem die Illusion des Anschlusses an die Bourgeoisie geraubt wurde, die hier vor allem thematisiert wird. Mit erstaunlicher Klarsicht beschreibt Vera Ferra das soziale Biotop einer am unteren Ende der gesellschaftlichen Skala sich angekommen wähnenden Mittelschicht. Keine Arbeiter oder Außenseiter, sondern „brave“ und „ehrliche“ Leute, denen der Boden unter den Füßen weggezogen wurde und die nun in dieser Bastion der Abgehängten einen aufreibenden Krieg nach innen führen. Also dort, wo es keine Sieger geben kann, weil der wirkliche Gegner ganz woanders zu suchen wäre.
Wenngleich im Roman immer wieder sozialdemokratische Rhetorik aufblitzt, entzieht er sich durch den dramaturgischen Kniff, ihn im Zeit- und Ortlosen spielen zu lassen, dennoch der ideologischen Zuordnung. Anfangs ist man beim Lesen irritiert, dass mit keinem Wort Nationalsozialismus, Krieg, Zerstörung oder Besatzung zur Sprache gebracht werden. Wie ist so etwas 1947 möglich? Und auch die Stadt, in der der Roman spielt, bleibt namenlos. Vieles deutet auf Wien: der Strom, die „auf dem Wasser schwimmende Fischerhütte“, wie sie am Donauufer häufig zu sehen war, die Straßenbahn, die Kauf-, Wirts- und Zinshäuser und nicht zuletzt die nach Deutungshoheit drängenden Jungkünstlerzirkel, denen Vera Ferra selbst angehört, die Avantgarde der Schuldlosen, die sich in Kaffeehäusern, Kellerbars und Wohnungen versammelt, um nicht „dem Glanz von vorvorgestern“ zu erliegen, wie Andreas Okopenko in seiner Ablehnung der offiziellen Kulturpolitik und deren Rückbesinnung auf die „österreichische Eigenart“ es ausdrückt.

Während die Verortung einer Geschichte im namenlosen beziehungsweise fiktiven Irgendwo ein probates Stilmittel der Literatur - und ganz besonders der Nachkriegsliteratur - ist (etwa auch in Ilse Aichingers „Die größere Hoffnung“ oder in Hans Leberts „Die Wolfshaut“), um das Geschehen ins Allgemeine und Gleichnishafte zu rücken, ist die Aussparung der Zeit in einem realistischen Roman doch ein Wagnis. Der Verdacht des Verschweigens oder Verdrängens steht im Raum, der berühmte Elefant also, von erdrückender Präsenz, die nicht zur Sprache findet. „Die Sackgasse“ könnte genausogut in der Zwischenkriegszeit wie in den 1950er und sogar noch 1960er Jahren spielen, es fehlen alle äußeren Anzeichen einer von Diktatur und Krieg zerstörten Großstadt. Doch diese Leerstelle verdeutlicht nur umso mehr die innere Verwüstung der Individuen und die Deformation der Gesellschaft durch eine Kette politischer Katastrophen, die ja im Bewusstsein der Lesenden verankert ist und auf die nicht noch einmal explizit hingewiesen werden muss. Die Lektüre funktioniert durch das Kurzschließen der Erzählung mit den Erfahrungen und dem Wissen der Lesenden.
Hinweis: Dieser Text ist die stark gekürzte Fassung des Nachwortes zur Neuausgabe von Vera Ferra-Mikuras Roman „Die Sackgasse“, die vor kurzem im Milena Verlag erschienen ist.
Die lieferbaren Kinderbücher von Vera Ferra-Mikura sind im Jungbrunnen Verlag erschienen.
Wir danken Herrn Erik Mikura für die freundliche Genehmigung zum Abdruck der privaten Porträtfotos der Autorin.







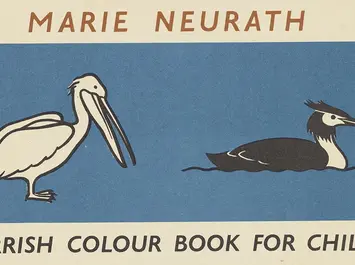

Kommentar schreiben
Kommentar schreiben
Kommentare
Keine Kommentare