
Black Lives Matter-Demo am 4. Juni 2020 in Wien, Foto: simon INOU
Hauptinhalt
Ein Jahr Black-Lives-Matter Demos in Wien
„Nichts muss so bleiben!“
Vor einem Jahr kam es in Wien und auch in anderen Städten Österreichs zu großen Black-Lives-Matter-Demonstrationen. Anlass war der Mord an George Floyd durch den Polizisten Derek Chauvin in Minneapolis, Minnesota. Wie haben Sie die damaligen Proteste in Wien erlebt?
Nicht nur ich war von der Größe der Proteste überrascht. Ich hatte zwar erwartet, dass sich sehr viele Menschen aus den Schwarzen Communities versammeln werden, denn es gab schon seit vielen Jahren großes Engagement und auch Demos. Aber dass vor allem junge Menschen so zahlreich auf die Straße gegangen sind, hat mich sehr gefreut. Die Organisator*innen hatten vielleicht mit 5000 Personen bei der Kundgebung am Karlsplatz gerechnet, letztlich kamen 50.000! Und selbst in den anderen Landeshauptstädten kam es zu starken Protesten. Als ich in Wien Plakate gesehen habe, auf denen die „White Supremacy“ angegriffen wird, da habe ich gewusst: Jetzt ist das Thema endlich auch bei uns angekommen.
Ich war im Mai 1999 bei der ersten Demo gegen Polizeigewalt nach dem Tod von Marcus Omofuma. Es gab im gleichen Monat auch die Operation Spring, bei der mehr als 300 Polizisten in ganz Österreich Wohnungen von Schwarzen Menschen durchsucht haben, es gab 127 willkürliche Festnahmen. Auch zu mir sind sie gekommen, um vier Uhr früh, und haben meine Wohnung auf den Kopf gestellt. Aber die Proteste gegen Polizeigewalt damals und die von vor einem Jahr sind nicht miteinander zu vergleichen. Die Ermordung George Floyds hat ein globales Phänomen ausgelöst. Es gab auch erstmals auch wirtschaftliche Reaktionen. Die großen Konzerne, die normalerweise immer schweigen, haben ganz klare Zeichen gegen Rassismus gesetzt. Und hier in Österreich trägt die antirassistische Arbeit, die seit Jahrzehnten von verschiedensten Organisationen und Menschen geleistet wird, endlich Früchte. Vor kurzem hat die Bundesregierung das neue Kompetenzzentrum Antirassismus vorgestellt. Auch an solchen Schritten sieht man: Es bewegt sich etwas. Es gibt Anlass zur Hoffnung.
Erstaunlich war auch, dass sich die Demonstrantinnen und Demonstranten nicht von Corona haben aufhalten lassen.
Wie man sicher demonstrieren kann, war natürlich bei der Organisation ein Thema. Es gab klare Regeln und Desinfektionsmittel. Man war aber nicht auf so viele Menschen vorbereitet, auch was die Lautsprecher betrifft. Was es gezeigt hat: Corona stoppt keine Morde. Daher muss man auch trotz Corona aufstehen und dagegen protestieren.

Es gab auch die Kritik, dass manche vielleicht gegen etwas protestiert haben, das vermeintlich weit weg ist.
Österreich ist ein kleines Land an der Peripherie der USA. Die globale Macht spielt daher eine zentrale Rolle. Jedes Mal, wenn in den USA ein Schwarzer getötet wird, wird darüber berichtet. Wenn das in Österreich passiert, gibt es keine ähnliche Aufmerksamkeit, siehe Omofuma. Eine entscheidende Rolle hat das Video gespielt, das die Ermordung von Floyd dokumentiert und über Social Media geteilt wurde. Zu sehen, wie jemand fast neun Minuten sein Knie auf den Hals eines Menschen drückt, hat das ganze Ausmaß der Gewalt vor Augen geführt. Aber es ist nicht nur ein Thema der USA, so etwas kann genauso bei uns passieren.
Die Proteste hier in Österreich haben auch damit zu tun, dass eine neue Generation von jungen Schwarzen Menschen da ist, die zu viel gesehen hat. Wir haben die Geschichten gehört, wir haben sie selbst erlebt. Wir wissen, was unseren Vätern oder Brüdern passiert ist. Wir wissen, wie es sich anfühlt, durchs Leben zu navigieren, wie es ist, von der Polizei kontrolliert zu werden. Und dass noch immer viel zu wenig passiert. Es gab daher vor einem Jahr die Gelegenheit, den Fall Floyd mit der österreichischen Situation zu verbinden. Darauf aufmerksam zu machen, dass es auch hier Rassismus gibt, wenn auch vielleicht in anderen Ausformungen. Viele haben die Chance genützt, haben gepostet, Bücher empfohlen und Demos organisiert.
Ich habe es sehr traurig gefunden, dass viele österreichische Medien die Black Lives Matter-Demos nur auf die USA fokussiert haben, nach dem Motto: Bei uns gibt es sowas nicht. Und ich glaube, diese Attitude ist sehr gefährlich. So wie es auch gefährlich ist, zu glauben, dass Rassismus nur in der FPÖ vorkommt. Die Tötung Omofumas ist nicht unter einer FPÖ-Regierungsbeteiligung passiert. Der damalige Innenminister Karl Schlögl war von der SPÖ und konnte sich eine Zusammenarbeit mit der FPÖ gut vorstellen, so wie es auch heute manche in der SPÖ gibt, die das wollen, nur weil sie Angst haben, Wählerstimmen zu verlieren. Und das bei einer Partei, die Solidarität als Grundlage haben sollte. Das wäre wirklich schade für die Sozialdemokratie Österreichs. Es gibt innerhalb der Polizei noch immer einen strukturellen Rassismus, aber nicht alle Polizisten sind Rassisten. Es gibt innerhalb all dieser Insitutionen Menschen, die Diskriminierung bekämpfen wollen, und mit Black Lives Matter kommt ein anderer Wind auf. Die Wiener Polizei hat sich ja anlässlich der Demos auf den Screens ihrer Fahrzeuge sogar deutlich zu Antirassismus bekannt. Wir müssen solche Bestrebungen bündeln.
Sie haben eine Stadterkundung an Orte des Schwarzen Widerstandes konzipiert, die Sie fürs Wien Museum im Sommer durchführen werden. Welche Geschichten wollen Sie dabei erzählen?
Es gibt ganz unterschiedliche Wege, das zu machen, und die Themen gehen uns nicht aus. Wir können natürlich nicht alles abgehen, manches wird nur gestreift. Aber man kann eine Geschichte erzählen, die die zwischen Angelo Soliman im 18. Jahrhundert und dem Fall Marcus Omofuma konkrete Beispiele benennt. Es ist ja nicht so, dass dazwischen nichts gewesen wäre. Man kann sich Straßennamen ansehen, Orte, an denen koloniale Waren angeboten wurden, oder auch die sogenannten Menschenzoos, die es ja auch in Wien gab. Wir haben Spuren von Schwarzen Menschen, die in den 1920er und 1930er Jahren in Wien waren, gefunden und werden auch auf das Schicksal Schwarzer Menschen in der NS-Zeit eingehen. Es gab die „Befreiungskinder“, also die Kinder der US-Soldaten nach 1945, und es gab Studierende aus afrikanischen Ländern in den 1960er und 1970er Jahren, als die Lebensumstände auch schwierig waren.

Angelo Soliman (um 1721-1796) auf einem Porträt von Johann Gottfried Haid (Kupferstecher nach einer Vorlage von Johann Nepomuk Steiner), um 1750, Wien Museum

Tiefpunkt der rassistischen Hetzkampagne gegen Marcus Omofuma, Kronen Zeitung vom 5. Mai 1999, Wien Museum
Wir werden vor allem selbstermächtigende Geschichte erzählen. Das heißt, wir stellen Schwarze Menschen in ihrer Geschichte nicht nur als Opfer dar, sondern als Menschen. Wir wollen sie aus ihrer Anonymität herausholen, hinter jeder Person gibt es eine Familie und Freundschaften. Lange Zeit gab es kein Interesse an deren Geschichte, etwa auch in der Forschung zur NS-Zeit, als Menschen aus West- und Nordafrika und der Karibik hier gelebt haben, verfolgt und getötet wurden. Zugleich gab es auch immer den Widerstand gegen Rassismus, auf den wollen wir ebenso hinweisen.
Wie ist Schwarze Geschichte in unsere Stadt eingeschrieben?
Wir haben überall in der Stadt ein bestimmtes Bild von Schwarzen Menschen. Es ist fast immer nur das Bild eines Objekts, nicht eines Subjekts. Schwarze Menschen sind, wie bei den Menschenschauen, vor allem zum Anschauen, zur Unterhaltung da, sie haben sehr viel Dienendes und sind nie in der Position der Stärke. Dabei gab es genug Personen, die aufgestanden sind und etwas verändern wollten. Deren Geschichte wollen wir erzählen. Wir kennen das Schicksal von Angelo Soliman. Aber die Tochter, die sich gegen den posthumen Umgang mit dem Leichnam ihres Vaters gewehrt hat, was wissen wir über sie? Sehr wenig.
Ganz konkret geht es uns auch um die kleine und die große „M“-Gasse im zweiten Bezirk. Da sagen wir ganz klar: So etwas gehört nicht in eine moderne Stadt. Noch ein anderes Beispiel: Es gibt im Arkadenhof der Universität ein Denkmal für den Anthropologen Rudolf Pöch. Er hat Menschenknochen in Südafrika, Namibia und Botswana gesammelt und sie für seine rassistischen Forschungen genutzt. Ein Teil seiner Sammlung wurde erst vor kurzem zurückgegeben und in Südafrika bestattet. Warum muss ausgerechnet er ein Denkmal haben? Und wir stellen noch andere Fragen: Warum muss eine weibliche Figur im zur Darstellung Afrikas als Erdteil hinter dem Naturhistorischen Museum, die Afrika repräsentieren soll, halbnackt sein? Wie ist das Traditionsgeschäft Julius Meinl am Graben zu seinem Reichtum gekommen? Es gibt unzählige solcher Beispiele in Wien.

Es gibt, ausgehend vom Karl-Lueger-Denkmal, gerade eine heftige Diskussion über den Umgang mit solchen Fällen. Wegräumen? Kommentieren? Welche Position vertreten Sie da?
Der heutige Universitätsring hieß früher Dr.-Karl-Lueger-Ring. Es war selbstverständlich richtig, ihn umzubenennen. Daher gehört auch das Lueger-Denkmal weg, weil ein Antisemit in Wien keinen Platz haben sollte. Den Platz kann man umgestalten und dort an andere Leute erinnern, die das Gegenteil gemacht haben.

Man muss sicher von Fall zu Fall entscheiden, aber grundsätzlich bringt Kommentierung allein gar nichts. Denn Kommentare lesen die wenigsten Leute, eine richtige Aufarbeitung passiert nicht in einem Kommentar. Man muss die Dinge entfernen, um zu zeigen, dass sie nicht mehr da sein sollen. Man kann ja danach kommentieren, aus welchen Gründen etwas weggegeben wurde. Geschichte ist im Fluss, wir sehen, wer geehrt wurde, aus welcher Perspektive und warum. Also kann und sollte man diese Geschichte auch verändern. Wir kennen die Diskussion rund um Sprache. Sprache verändert sich, Städte verändern sich genauso. Warum sollte man also bestimmte Plätze oder gar Straßennamen so belassen? Nichts muss so bleiben! So wie Antisemitismus und Rassismus nicht bleiben müssen.

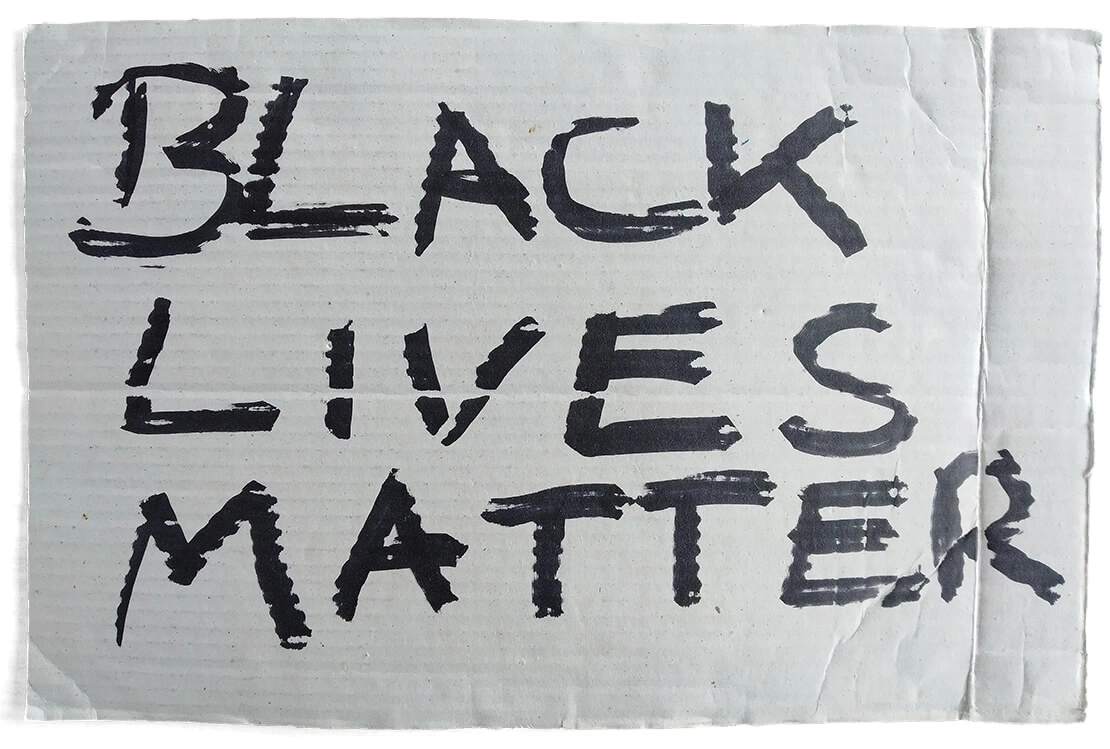


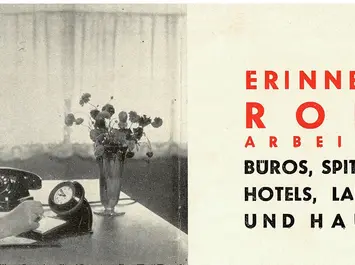


Kommentar schreiben
Kommentar schreiben
Kommentare
Keine Kommentare