
Karikatur in Kikeriki, 21.11.1920, Wienbibliothek im Rathaus
Hauptinhalt
Trennung Wiens von Niederösterreich 1920
Der Scheidungsprozess als Kulturkampf
Das österreichische Bundesverfassungsgesetz vom 1. Oktober 1920 kündigte zwar die Trennung zwischen Wien und Niederösterreich an, aber ließ die konkrete Umsetzung offen. Realpolitisch waren sich die beiden großen Parteien, die die Sezession anstrebten und durchziehen wollten, in der Zielsetzung durchaus einig. Das größte Bundesland trennt sich zwei Teile. Wien steigt zu einem eigenen Bundesland auf. Die Wiener Sozialdemokraten wollten mögliche Einsprüche des Landes Niederösterreich los werden, genauso wie die niederösterreichischen Christlichsozialen, mit ihrem Machtzentrum Bauernbund, darauf fokussiert waren, dass bei einer Trennung ihre relative Mehrheit im Land unangefochten war.
In der Außendarstellung inszenierten die Hauptakteure die Zerschlagung des Landes in zwei Teile als wenig spektakulären Vorgang. Studiert man die Landtags- und Gemeinderatsdebatten und die Zeitungsberichte, ging es bei der Abwicklung, auch bei der schnellen Weiterentwicklung von einer partiellen zu einer totalen Loslösung, einigermaßen pragmatisch zu. Die beiden großen Parteien waren bei aller Streitbarkeit darauf bedacht, die Abwicklung glatt hinter sich bringen; ein Scheitern war ausgeschlossen. Allen waren klar, dass der komplizierte Prozess, bei dem ein altes Kronland aufgelöst wurde, nur durch Kompromisse zu erzielen war.
Die Scheidungsverhandlungen zeigten ein für die große Koalition der Ersten Republik typisches Bild. Zähes und energisches Verhandeln und Kompromissbereitschaft auf der einen Seite, ein erbitterter Kulturkampf auf der anderen. Die Hauptbühne dieser Spannungen und Auseinandersetzungen waren zweifellos die unterschiedlichen materiellen Interessen, orchestriert von pompöser Begleitmusik. Gleichzeitig gehörten zum großen Drama der Umbruchsjahre auch die zahlreichen Nebenbühnen, auf denen mit großer Rhetorik in mannigfacher Form um die gesellschaftliche Neuordnung, um die Parteienbindung, um die Gestaltung des Alltags, um die Identität, um das Geschichtsbild oder um die Symbole des Lebens gestritten wurde.
Was die Empörung besonders anfachte, war, dass die zentral gesteuerte Zwangsökonomie mit ihren Requirierungen weiterlief; diese schrieb den Bauernhöfen die Ablieferung von Getreide, Gemüse oder Vieh unter einem sogenannten Höchstpreis vor. Die Bauern wollten auf dem Markt verkaufen, endlich wieder gute Preise erzielen und die Situation ihrer Wirtschaften verbessern. Die staatlichen Vorschreibungen und ungeliebten Zwangsablieferungen gegen Fixpreise waren ihnen ein Dorn im Auge. Weil die Staatsmacht, die Behörden oder die örtliche Gendarmarie versagten, die Kontingente einzutreiben, strengten Arbeiter- und Soldatenräte an ihrer Stelle Durchsuchungen und Requirierungen an, was den Hass auf das „Bolschewikensystem“ auslöste.

In der Stadt wiederum hatte man den Verdacht, dass die Bauern hauptsächlich den Schleichhandel bedienen wollten. Sozialdemokratie und Volkswehreinheiten hielten gegen den „Wucher“, versuchten den Schwarzmarkt, auf dem die Bauern viel Geld verdienen konnten, zu unterbinden. Der sogenannte „Rucksackverkehr“, bei dem es Lieferanten zu einem einträglichen Beruf brachten, wurde zum großen Politikum.
Aber nur zu einem Teil verbargen sich in dieser Konfrontation materielle Interessen. Aus den Interessensgegensätzen wuchsen die Ressentiments. Vorurteile legten sich wie eine Patina auf jeden vernünftigen Diskurs über die ausweglos scheinende Situation. Die Konfrontation wuchs sich zu einer besonders aggressiven Form der Identitätspolitik aus. Der Verweis auf Kriegsgewinnler und Spekulanten, die große Gewinne einstreiften, war schnell da und wischte alle Solidaritätsgefühle weg. Wien wurde als Stadt der „Schieber und Arbeiterräte“ punziert. Eine Reihe von Orten sperrten 1919 jede Sommerfrische für Wiener, anderen schränkten die Aufenthaltsdauer ein.
Unter den gesammelten Vorurteilen gegen Wien, die in den Gründungsjahren der Republik im Umlauf waren, war sicherlich die Schablonisierung Wiens zum Sündenbabel besonders effektiv, weil die Ausläufer jener seltsamen Vergnügungssucht auch die Dörfer erreichten. Wien wurde als „Sumpf“ wahrgenommen, der mit seiner Sitten- und Glaubenslosigkeit, mit seinen „Sever“-Ehen, seinen Kino- und Theateraufführungen, mit seinen Homosexuellen-Parties und Stundenhotels, mit seinen modisch-kokett gekleideten Frauen (Seidenstrümpfe, kurze Röcke, Bubikopf), mit seinem Nachtleben (Konzertcafés , Bars, Jazztänze) das gesamte Land kulturell gefährdete und von dem eine Ansteckungsgefahr ausging. Die Bauernorganisationen konnten sich auf die Pfarrer stützen, die sich in den Dörfern als Vorkämpfer gegen Atheismus und moralischen Untergang verstanden. Glöckels Schulreform gehörte zu den Lieblingsthemen, an denen sich der Protest formierte.

Der Antisemitismus im niederösterreichischen Bauernbund war notorisch. In der Zeitung seiner Mitglieder, „Der Bauernbündler“ (Auflage: 86.000), fanden sich in fast jeder Nummer diesbezügliche Einspielungen. Einmal ging es um die „jüdischen Schleichhändler“, dann wieder „um polnische Eindringliche“, dann wiederum gegen „Bela Kun & Co“, die in Österreich zeitwillig Asyl fanden, generell immer wieder gegen die „jüdische Sozialdemokratie“ oder den „jüdischen Bolschewismus“. Die Bauernvertretung drohte, die Geduld zu verlieren. „Man spricht viel von Judenpogromen, von Judenverfolgungen, wir hetzen nicht zu dieser Tat. Aber die sozialdemokratischen Führer treiben unser hungerndes und gepeinigtes Volk zu einer solchen ausartenden Verzweiflungstat.“
Die „Los von Wien“-Bewegung führte zu einem paradoxen Ergebnis. Aus der Defensive entstand ein neues Selbstbewusstsein, die Polarisierung konnte in ein Mehr an Zustimmung bei den Wahlen transferiert werden, die Position der Christlichsozialen Partei in der Stadtpolitik wurde marginalisiert. Das „Rote Wien“ verstand sich, auch dies ein Ergebnis der Kulturkämpfe, wie das sprichwörtliche unbeugsame gallische Dorf im schwarzen Österreich. Die „Trennungsfanatiker“ im niederösterreichischen Bauernbund, denen es nicht schnell genug gehen konnte, den „Wasserkopf“ Wien loszuwerden, hätten sich, so Oskar Helmer, verspekuliert. Obwohl vorgewarnt, hatten sie sich schwere Nachteile eingehandelt, indem das selbständige Niederösterreich die üppig fließenden Wiener Steuerquellen nicht mehr anzapfen konnte.

Der Jubel, in den nach Abschluss des Pakts Karl Renner in einem Kommentar in der „Arbeiter-Zeitung“ verfiel, hätte bereits den Christlichsozialen signalisieren können, dass sich die Sozialdemokraten trotz aller Zugeständnisse als Verhandlungssieger sahen. Die hauptsächlich von den Christlichsozialen betriebene Trennung sei, so Renner, die Geburtsstunde des Roten Wien. Die nun vorhandene finanz- und steuerpolitische Unabhängigkeit des „Freistaats“ sei die Voraussetzung dafür, um eine sozialistische Modellstadt in Europa zu schaffen. „Der 1. Jänner 1922 ist für die Stadt Wien ein geschichtlicher Tag ersten Ranges. …Wien ist heute das größte städtische Gemeinwesen der Welt, das von Arbeitern verwaltet wird! Und das unter beispiellosen, unerhörten Schwierigkeiten mit dem vollständigsten Erfolg, der je einer Partei in so kurzer Zeit beschieden war. Die Stadt, auf deren Hauptplatz nach feindlichen Prophezeiungen das Gras wachsen sollte, die Stadt, die kurzsichtige Landsleute selbst mit einem Wasserkopf verglichen hatte, diese Stadt ist durch die Tüchtigkeit seiner Verwalter auch staatsrechtlich und politisch erhöht und zur vollen Selbständigkeit geführt worden.“
In der gleichen Ausgabe der „Arbeiter-Zeitung“ zog Hugo Breitner Bilanz über seine „proletarische Steuerpolitik“. Auch wenn die Opposition den Untergang Wiens prophezeite und spottete, dass jeder Monat eine neue Steuer bringe, hielt die sozialdemokratische Gemeindeverwaltung selbstbewusst dagegen, dass damit ein Fundament für eine neue Dimension von Kommunalpolitik geschaffen worden sei.
Das Stimmungshoch der Sozialdemokraten durfte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die komplette Trennung der beiden Landesteile schon das Ende der Auseinandersetzungen gewesen wäre. Der ausgehandelte Kompromiss führte nicht zur Befriedung, sondern bildete den Einstieg in die nächste Etappe des Streits. Die Einrichtung in den Status quo sollte nur ein vorübergehender Zustand sein. Alles schien entschieden, und zugleich waren für die beiden Großparteien viele Fragen offen. Auf sozialdemokratischer Seite galt die Devise: „Vom ‚Roten Wien‘ zum roten Österreich“. Das Beispiel der Verwaltungsarbeit in der Bundeshauptstadt sollte Überzeugungsarbeit für alle Bundesgebiete leisten. Bei den Christlichsozialen lösten der Verfassungsbeschluss und der Wahlerfolg, beide im Oktober 1920, Kampfansagen aus. Ignaz Seipel, die große Stratege in der Partei, sagte es ganz offen: Es gelte, „diesen roten Anstrich von Wien herunterzukratzen! Wir Christlichsoziale werde das Möglichste dazu tun, daß dieser Farbenunterschied zwischen den Ländern draußen und Wien nicht mehr besteht.“
Bei diesem Text handelt es sich um einen stark gekürzten Beitrag aus dem Band „Wien wird Bundesland. Die Wiener Stadtverfassung 1920 und die Trennung von Niederösterreich" (Hg.: Bernhard Hachleitner und Christian Mertens, Residenz Verlag), der anlässlich einer Ausstellung der Wienbibliothek im Rathaus erschienen ist.




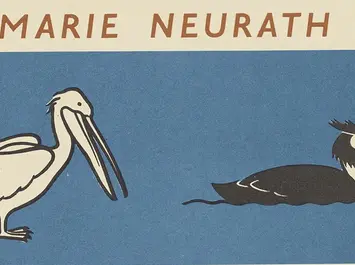
Kommentar schreiben
Kommentar schreiben
Kommentare
Keine Kommentare