
Foto: Susanna Hofer
Hauptinhalt
Im Haifischbecken
Diverse Körper von Gewicht
Als ich vom Frühstücksteller des Intercontinental Hotel Kabul aufsah, schwebte ein zorniger Adler vor meinen Augen. Auf der Gürtelschnalle prangte zudem der Schriftzug „USA“ als metallenes Relief. Nach oben verlief ein farbig kariertes Hemd, nach unten strömte eine lose sitzende Blue Jeans herab. Ich hob den Blick und traf auf ein fleischiges, braungebranntes Gesicht mit Knubbelnase und fortgeschrittener Halbglatze. Der mittelgroße Mann hatte die linke Hand lässig in der Gürtelschlaufe seiner Blue Jeans eingehakt. Die rechte Hand war zur Begrüßung ausgestreckt. „Hello, I’m Sam“, erklärte mir der US-Afghane. Seine Gattin hatte uns bereits erwartet und schon begrüßt. Offensichtlich war sie es gewesen, die auf diese Einladung bestanden hatte. Das Paar residierte hier und wir sollten dies unbedingt zur Kenntnis nehmen. Geschenkt. Ich war also mit diesen, mir gänzlich fremden Menschen verwandt, relativ eng sogar. Ich suchte nach Familienähnlichkeiten, fand keine und war erleichtert.
Wenn man Verwandtschaft für einen Moment aus ihrer Verwickelung in Erbschaftsverhältnisse, Hausgemeinschaften und Dynastischem löste, konnte man sie als besondere Nähe von Körpern in den Blick nehmen. Als Ähnlichkeit von Fleisch. Das Paar mit afghanischen Genen war im Lauf der Jahre mit den Menschen, mit denen sie die Lebensumstände, Ernährungsgewohnheiten und Lebensmittelökonomien teilten, viel enger verwandt geworden als sie es mit mir noch waren. Frittierfett ist dicker als Blut.
Mein Blick fiel auf die lebensgroßen Ton-Leoparden, die im Raum verteilt waren. Tierliche Körper scheinen so plastisch zu sein wie die mit ihnen verbundenen Subjektivitäten. Die Körper von Hunden, oft so anschmiegsam und zutraulich, können durch züchterische Interventionen innerhalb weniger Jahrzehnte gigantisch aufgebläht oder winzig miniaturisiert werden. Bei den oft eigenbrötlerischen und widerspenstig-autonomen Katzen hingegen kann es Jahrhunderte dauern, bis sich irgendeine körperliche Eigenschaft stabilisieren lässt.
Ich musste an meine verstorbene Freundin V. denken, die mir einmal vom Tod ihrer Mutter erzählt hatte, einer klassenbewussten Arbeiterin aus dem Ruhrgebiet. Als das Krankenhaus anrief, hatte V. alles in Wien stehen und liegen gelassen und war nach Deutschland geeilt. Alles zu spät. Sie traf ihre Mutter nur noch tot an. Etwas blieb ihr aber besonders eindrücklich, erzählte sie später, nämlich der Gesichtsausdruck, den die Frau, die sie einst ins Leben gebracht hatte, nun auf dem Totenbett im Keller des Krankenhauses trug. Es war, als hätten alle Muskeln ihres Gesichts das erlebte Leben losgelassen und einen Blick auf die Möglichkeitsform, die Offenheit im Antlitz jedes Menschen gewährt.
Der Gesichtsausdruck ist zu großem Teil eine Anspannung von Muskeln, die unmerklich Teil der Physiognomie werden. Zum Sich-Benehmen gehören die angemessenen Gesichtsausdrücke dazu. Das Sich-Verhalten kommt, wenn überhaupt, erst viel später. Zunächst wird man aber tausend Mal zurechtgewiesen, nicht auf diese oder jene Weise dreinzuschauen. Noch viel öfter handelt es sich freilich um unbekümmerte Assimilation ans Milieu. Dieser Prozess beginnt, wie der Spracherwerb, sehr früh. Auf jedem Kinderspielplatz fällt auf, dass schon Kleinkinder oft so dreinblicken und dastehen, wie es in der sozialen Klasse ihres Reproduktionszusammenhangs (‚Familie‘) üblich ist.
Das Gesicht im Keller des Krankenhauses hatte aber nicht mehr so ausgesehen wie das, was sie ein Erwachsenenleben lang gewesen war, eben eine widerspenstige Arbeiterin aus dem Ruhrgebiet. Auf der metallenen Totenpritsche sah sie nun wie eine Person aus, die im Leben alles hätte sein können: Opernsängerin, Forscherin, Revolutionärin. Diese Anmutung des Offenen hatte sie zeitlebens nicht gehabt. Sie war längst jemand besonderer geworden. Dies hatte sich in Gesicht und Körper niedergeschlagen. Auch unser Wort „Person“ stammt vom lateinischen „persona“ ab und bezeichnete ursprünglich die Maske von Schauspielern.
Dem deutschen Schriftsteller Jean Paul Friedrich Richter wird der Gedanke zugeschrieben, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt jeder Mensch für sein Gesicht selbst verantwortlich ist. In Wien fand ich mich von Unverantwortlichkeiten aller Art umgeben, die in Afghanistan undenkbar wären. Aber was hilft gegen die vielsagenden Gesichter und beredten Blicke der anderen? Eine Woche später gelang es den Aufständischen, eine enorme Bombe ins Hotel zu schmuggeln. Sie zerriss menschliche und architektonische, schuldige und unschuldige Körper gleichermaßen.
In Wien erzählte mir eine junge österreichische Filmemacherin von einer befreundeten arabischen Familie mit zwei Söhnen. Die Lotterie der Natur wollte es so, dass einer der beiden eine so dunkle Hauttönung aufwies, dass er vielen hier als unzweifelhaft ‚schwarz‘ erschien. Der andere hingegen sehe sehr ‚arabisch‘ aus. Die beiden jungen Männer berichteten, dass der dunkler Pigmentierte wegen seiner Hautfarbe sein halbes Leben lang Probleme in Wien gehabt habe, im vergangenen Jahrzehnt habe sich dies aber verkehrt. Er erfahre, ohne irgendetwas getan zu haben, viel Zuspruch, dafür sei nun aber sein Bruder fast täglich die Zielscheibe von subtilen Abwertungen und primitiven Anfeindungen.
Diskriminierung und Rassismus finden heute oft unter den ideologischen Vorzeichen des aufgeklärt ‚Guten‘ statt. Dies ist im österreichischen Film ein bekanntes Problem. Augenfällig ist dies auch beispielsweise im Fall der berüchtigten Kampagne der Wiener Linien gegen eine angeblich existierende ‚Bettlermafia‘, die ihre Mitglieder ausbeute. Die Offensive gegen die Ärmsten bewarb der kommunale Mobilitätsdienstleister mittels Plakataushängen in U-Bahn-Stationen, die öffentlich Stimmung gegen Menschen machten, die scheinbar nicht von hier waren – natürlich zu ihrem eigenen Schutz.
Der wohlmeinende Paternalismus kann aber genauso Einheimische treffen, die aus der Verwertungsnorm heiler Körper und Köpfe fallen. Eine junge Frau mit Trisomie 21, die ich bei einer Veranstaltung der Kulturinitiative Pro21 – Kampfassistenz kennenlerne, erzählt mir von ihren Heiratsplänen und ihrem Kinderwunsch. Obwohl es alle Nicht-Behinderten aus ihrem persönlichen Umfeld wissen, erzählt ihr niemand, dass sie auf Wunsch der Eltern und mit Unterstützung sozialarbeiterischer Betreuer:innen längst sterilisiert wurde und nie Kinder zur Welt bringen können wird. Nicht nur medizinischer und sozialstaatlicher Apparat, sondern auch so manche Philosoph:innen und Expert:innen begründen die Entfernung von Behinderung aus dem menschlichen Erfahrungsraum mit dem Wohl der Betroffenen. Dieses sei nämlich so eingeschränkt, dass ihr Leben als ‚lebensunwert‘ qualifiziert werden müsse – obgleich die Befragungen von Menschen mit und ohne Behinderungen keinen relevanten Unterschied des subjektiven Wohlbefindens zeigen. Die Angst, dass diese erwachsenen Wiener:innen womöglich ihre Sexualität frei ausleben könnten, ist mancherorts so tiefsitzend, dass dies offenbar eine Entmündigung und Beschneidung reproduktiver Rechte erlaubt. Eugenische Debatten diesseits und jenseits des Atlantiks aus der Zeit der vorletzten Jahrhundertwende hallen hier unter veränderten Vorzeichen nach.

Die gesellschaftliche Inklusion behinderter Menschen gilt heute zunehmend als wichtiger Gradmesser dafür, wie weit ‚liberale Demokratien‘ schon gekommen sind. Interessanterweise sind es oft genau diese Gesellschaftsformationen, die durch ökologisch und sozial fatalen Rohstoffabbau sowie ihre militärische Präsenz im globalen Süden ein Vielfaches an Menschen verletzten, verstümmeln, zu geistig und körperlich Behinderten machen.
Während in Spanien 2024 eine Person mit Trisomie 21 erfolgreich als Parlamentsabgeordnete kandidierte, gibt es in Österreich noch einiges zu tun. Es bleibt zu hoffen, dass das Spektakel der anderen mehr hervorbringen wird als ‚ability grouping‘, das beispielsweise Menschen mit Trisomie 21 traditionell Tanz- und Theaterbühnen zuweist, während neurodiverse Autist:innen von Hedgefonds umworben werden, weil sie komplexe mathematische Aufgaben schneller lösen können.
Barrierefreiheit ist heute in aller Munde. Und das ist gut so. Denn die Stadt, aber auch Mode und Bildung stehen nicht allen Körpern in gleicher Weise offen. Metaphorisch diente der Körper schon in der römischen Antike als Bild für Staat und herrschaftliche Ordnung. In der Moderne nahm der Städtebau die verstopften Arterien vormoderner Verkehrswege als Problem in den Blick. In Wien wurde 1861 das Stück der Wieden, das über den alten Linienwall als militärische Abwehranlage hinausragte, administrativ abgetrennt und wird seitdem der zehnte ‚Hieb‘ genannt – so wie auch sonst durch stadtplanerische Entscheidungen gewachsene Strukturen durchhauen wurden. Als damals aus der Stolperfalle für feindliche Heere der Gürtel entstand, der bald zu einem der wichtigsten innerstädtischen Verkehrswege wurde, war es offenbar nicht vorgesehen, die Bezirksgrenze zwischen viertem und fünftem Bezirk zum zehnten hin auf würdevolle oder elegante Weise zu queren.
Ganz in der Nähe hatte der Philosoph Ludwig Wittgenstein auf der Wieden das Gymnasium besucht. Es steht noch immer auf dem Gelände des ehemaligen Jagdschlosses Favorita, von dem sich der Name für den zehnten Bezirk ableitet. Von Wittgenstein stammt die Empfehlung, sich die menschliche Sprache wie eine alte Stadt vorzustellen.
Ob dies auch umgekehrt galt? Wenn man die Stadt als Sprache denkt, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Wien mit sich selbst nicht immer flüssig spricht, sondern manchmal gebrochen und abgehakt. Die Grammatik des urbanen Raums trennt mitunter mehr als sie verbindet. So versandet beispielsweise die wichtigste Einkaufsstraße des Landes, die Mariahilferstraße, wohl nicht unabsichtlich auf der Rückseite des Kunsthistorischen Museums, anstatt Flanierer:innen oder Demonstrant:innen städtebaulich angemessen oder zumindest praktikabel ins historische Zentrum der Stadt zu führen. Dazu muss in jedem Fall die Ringstraße überquert werden, die heute bekanntlich dort steht, wo sich früher Wehranlagen der Stadtmauer befanden. Beim Bau der Ringstraße war das Revolutionsjahr 1848 noch gut in Erinnerung, als politisch erregte Körper die Straßen eroberten. Als die Stadtmauer, die längst nicht mehr einen äußeren, sondern einen inneren Feind, das Vorstadtproletariat, abwehren sollte, geschleift wurde, ließen die Militärs als Wiedergutmachung ab 1849 unter anderem das Arsenal bauen. Das Arsenal richtete sich nicht gegen einen äußeren Feind, sondern wurde zur Bekämpfung revoltierender Wiener:innen konzipiert. Die Stadt zeigt in seiner gebauten Syntax noch immer die Spuren eines polizeilichen Kalküls.
‚Diverses‘ – das klingt wie etwas, wofür es in der Steuererklärung sonst keinen Platz gibt. Oder wie der allerletzte Punkt der Tagesordnung eines Vereinstreffens, wenn alle schon heimgehen wollen. Die Abstraktion Richtung ‚Diversität‘ macht die Sache kaum besser. Rührend ist hingegen just die Hilflosigkeit, mit der Wohlmeinende und Wohlgesonnene nach der korrekten Bezeichnung für ‚die anderen‘ suchen – und plötzlich auf dem sicher geglaubten Boden der eigenen Sprache ins Rutschen kommen. Gerade diese Unsicherheit ist das Interessante daran. Das tastend Nach-Worten-Ringen, nicht wissend, ob man versehentlich das Gegenüber beleidigt oder sich selbst als gänzlich ignorant zu erkennen gibt. In diesem Moment wird man selbst zum Neu-Ankömmling. Schließlich geht es allen so, die von ganz woanders ankommen und das Gefühl haben, ständig alles falsch zu machen, nicht die passenden Worte oder Betonungen zu finden.
Language is a Virus ist der Titel eines Liedes der Künstlerin Laurie Anderson, das sich auf das Buch The Ticket That Exploded (1962) des Schriftstellers William S. Burroughs bezieht. Burroughs beschreibt darin den ‚Virus Sprache‘ als etwas, das aus dem Weltall stammt. In der Tat verwenden wir sprachliche Formen auch, um die intimsten und persönlichsten Aspekte unseres Seins artikulieren zu können. Unsere Worte stammen aber von Menschen und aus Zeiten, die den unseren Jahrzehnte, Jahrhunderte oder Jahrtausende vorausgehen, die nichts mit uns zu tun haben, eigentlich etwas durch und durch Fremdes sind. Das extrem Fremde, das gleichsam unmenschlich Andere von Sprachlichkeit übersteigt Vorstellungen transparenter Kommunikation und weist auf das Unheimliche der Manipulation unserer Wahrnehmung durch Sprache hin.

Gewiss machen alte und neue Wörter bis zu einem gewissen Grad Welt, doch die Welt besteht nicht aus Wörtern. Innerhalb einer von extremen Ungleichheiten geprägten Welt kann die Politisierung von Sprache nie mehr sein, als auf die Beziehung von Sprache und Macht hinzuweisen, sie offenzulegen, zu irritieren und Erstarrtes wieder beweglich zu machen. Die eigentliche Herausforderung besteht dabei nicht darin, die aktuell als ‚gerechter‘ eingeschätzte Sprache allen Uneinsichtigen gekonnt zu vermitteln, sondern die Verhältnisse zu verändern, mit denen diese Wörter verbunden sind. Zu den Verhältnissen gehören natürlich auch die Wörter selbst. Hier wäre ein Methodenpluralismus empfehlenswert. Auf ganz unterschiedliche Weisen Sprache spielerisch und humorvoll zu untergraben, könnte mehr Menschen dazu einladen, sich daran zu beteiligen, anstatt als Ignorante ans Empfangsende der Wahrheit platziert zu werden. Dies würde es auch leichter machen, imaginativer, poetischer und konsequenter mit dem Verhältnis von Sprache und Macht umzugehen. An politisch korrektem Deutsch ist nur seine Übertreibung wahr.

Zugleich können bei einer übermäßigen Betonung von Fragen der Benennung und Identität soziale Fragen in den Hintergrund gedrängt werden. Dabei besteht zudem die erhebliche Gefahr, auch der unsinnigsten scheinfortschrittlichen oder gar einer reaktionären Position auf den Leim zu gehen, weil die Ohren vom süßen Honig korrekter Sprachlichkeit verklebt sind. Identitätspolitik ist ein Kampf, den keine linke Kraft gewinnen kann. Es ist der Boden der Rechten.
Viele Arbeiter:innen wissen mit neueren Sprachpolitiken nicht viel anzufangen – das ist kein Defizit, sondern im Gegenteil Ausdruck der stimmigen Erkenntnis, dass Universitäten und ihre gehobenen Sprechweisen Institutionen der Macht sind, die sich oft genug gegen sie gerichtet haben und noch immer richten. ‚Geschlechtergerechte‘, ‚-sensible‘ oder sonstige ‚progressive‘ Sprachpolitiken einzufordern, während man selbst kaum anders denken oder sprechen kann als im hauptstädtischen, bildungsbürgerlichen oder universitären Jargon, ist zutiefst elitär. Den meisten unterprivilegierten Frauen in Wien, ganz gleichgültig ob autochton, migrantisch oder postmigrantisch, wären vermutlich mehr Rechte, Geld und Urlaub wichtiger und unmittelbar einsichtiger als die Frage ihrer Adressierung. Dies heißt nicht, dass Fragen der Benennung egal sind, sondern dass sie in ein adäquates Verhältnis zu setzen sind. Hier ist strategische Vernunft gefragt, um sich nicht bloß in moralischer Rechtschaffenheit zu üben oder kritische Distinktionsgewinne abzuschöpfen, sondern auch einmal gesamtgesellschaftliche Kämpfe zu gewinnen. Denn nicht jede abstrakt legitime Forderung ermöglicht gleichermaßen ihre Verallgemeinerung. Nicht ganz unwichtig wäre es beispielsweise auch, die Sprache der Medizin oder des Rechts inklusiver zu gestalten. Wie kann es beispielsweise sein, dass Kollektivverträge in einer Sprache verfasst sind, die der Großteil der Betroffenen nicht versteht? Dass diese Dimensionen selten Teil der Diskussion sind, zeigt den verdrängten Klassencharakter verbreiteter ‚progressiver‘ Forderungen.
Was die Grenzen des guten Geschmacks und die Würde des Menschen verletzt, was der Anstand verbietet und was aus der Zeit gefallen ist, muss jede Generation aufs Neue aushandeln. Was vorgestern noch zum guten Ton gehörte, kann schon morgen hochnotpeinlich sein. Deshalb würde es öffentlichen Einrichtungen wie beispielsweise Theater- und Kunsträumen, Medien und Filminstitutionen gut zu Gesicht stehen, nuanciert und differenziert mit kritischen Befragungen bislang möglicherweise nicht ausreichend reflektierter Routinen umzugehen. Dies bedeutet, nicht jeden akademischen oder ‚aktivistisch-progressiven‘ Trend übernehmen zu müssen. Sich mit dem Unwort ‚woke‘ oder sonst wie gegen jede Kritik zu immunisieren, ist aber der gesellschaftlichen Debatte, für die diese Räume Zuständigkeit und öffentliche Gelder beanspruchen, ebenso nicht zuträglich. Wir alle sind aufgefordert, uns neuen Ideen nicht voreilig zu verschließen, eventuell können wir etwas dazulernen.
Zugleich werden die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht im Sinne einer geradlinigen Fortschrittsgläubigkeit einfach immer besser. Wer oder was in den Genuss erhöhter Aufmerksamkeit kommt, folgt nicht-unschuldigen Konjunkturen. Zudem kann das, was für die eine Gruppe sinnvoll sein mag, für andere einen Holzweg darstellen. Hier geht es auch nicht einfach um ‚Marginalisierte‘, die endlich die Bühnen der Sichtbarkeit erklimmen, sondern auch um Verteilungskämpfe in Sachen Definitionsmacht. Diese ist mit ökonomischen, symbolischen und geopolitischen Dimensionen verbunden, die nicht außer Acht gelassen werden können.
Während des Höhepunkts der #BlackLivesMatter-Bewegung nach der polizeilichen Ermordung von George Floyd im Jahr 2020 wurden auch in Wiener kritisch-wissenschaftlichen bzw. progressiv-aktivistischen Kreisen zunehmend Personen, die nicht sofort und eindeutig österreichisch ‚weiß‘ aussahen, mit dem US-Anglizismus PoC bzw. People of Color (Sg.: Person of Color; wörtlich „Menschen von Farbe“) oder mit dem neueren BPoC (Black and People of Color) adressiert. Die Konjunktur dieser Begriffe trägt nicht einfach geteilten Erfahrungsräumen Rechnung, sondern steht in Beziehung mit sehr spezifischen US-amerikanischen Verhältnissen, Schwierigkeiten und Entwicklungen. Der, nicht selten naive, Einsatz dieser nach Österreich importierten Begriffsapparaturen zeigt eine bestürzende Verkennung der konkreten Kontexte und Realität vieler plötzlich in Wien so Adressierter, wie beispielsweise Afghan:innen. Die Konjunktur der genannten US-Anglizismen für Kategorien und Identitäten lässt sich nicht von der globalen US-Hegemonie in Sachen akademisch-aktivistischer Wissensproduktion, Popkultur und militärischer Menschenvernichtung trennen. Bestimmten betroffenen Kritiker:innen von Diskriminierung wird mitunter großzügig eine universelle Expertise zugesprochen, die nicht besteht.
Neue Selbstbezeichnungen sind Einsätze innerhalb eines Raums der Fremdbezeichnung und fremdbestimmter Kategorien. Es handelt sich um taktische Bewegungen innerhalb einer konkreten Konstellation, kein ‚Leo‘, zu dem man laufen kann, um sich unangreifbar zu machen. Der Widerspruch liegt manchmal nicht im Begriff, sondern in der Wirklichkeit. Zugleich können neue Benennungsregime und Adressierungsprogramme auch Ausdruck einer begrüßenswerten Sensibilisierung sein. Dies ist aber der falsche Ort für milieuspezifische Selbstgerechtigkeit. Wenn beispielsweise die Kronen Zeitung im Jahr 1999 im Kontext der polizeilichen Ermordung von Marcus Omofuma den verzweifelten Kampf eines 26-Jährigen um sein Leben auf der Titelseite als ‚Toben‘ bezeichnet, so appelliert diese Rahmung an die übelsten und verabscheuungswürdigsten rassistischen Ressentiments. 2017 kommt dieses fragwürdige Prädikat jenem berüchtigten Falter-Cover nach der ‚Kölner Silvesternacht‘ zu, das eine unüberschaubare Menge von dunkelhaarigen, grimmig dreinblickenden Männern mit markanten Augenbrauen zeigt, die weinende Frauen mit hellen Haaren begrapschen, während einige der Männer einen hellhäutigen Polizisten abdrängen. Kellernazis und rechte Kulturkämpfer:innen müssen sich beglückt die Hände gerieben haben. Rassismus ist kein Hai, er ist das Wasser.

Dieser Text stammt aus der Publikation zur Ausstellung „Mixed. Diverse Geschichten“. Die Fotos für die Veröffentlichung im Magazin sind von Susanna Hofer.
Hakan Gürses: Die Dinge der Ordnung. Differenz, Sprache und das Politische angesichts des Neuen Materialismus, in: Werner Friedrichs, Sebastian Hamm (Hg.): Zurück zu den Dingen! Politische Bildungen im Medium gesellschaftlicher Materialität, Baden-Baden 2020, S. 217–232.
Noa K. Ha: People of Color, in: Inken Bartels, Isabella Löhr, Christiane Reinecke u. a. (Hg.): Inventar der Migrationsbegriffe, Bielefeld 2023, S. 253–268.
Ashifa Kassam: Mar Galcerán makes history as Spain’s first parliamentarian with Down’s syndrome, in: The Guardian, 9.1.2012.
Paul Starr, Edward P. Freeland: „People of Color“ as a category and identity in the United States, in: Journal of Ethnic and Migration Studies, 50 (2024) 1, S. 47–67
Joseph A. Stramondo: Bioethics, Adaptive Preferences, and Judging the Quality of a Life with Disability, in: Social Theory and Practice 47 (2021) 1, S. 199–220.
Jasbir K. Puar: The Right to Maim. Debility, Capacity, Disability, Durham 2017.
Ludwig Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, Frankfurt am Main 1975, S. 24.
Dina Yanni: Perspektiven auf Rassismus im österreichischen Film, Österreichisches Filminstitut, Wien 2024.


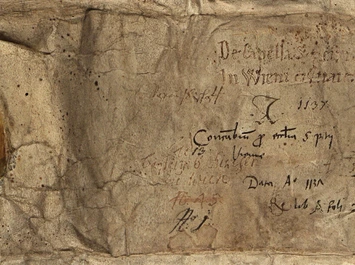

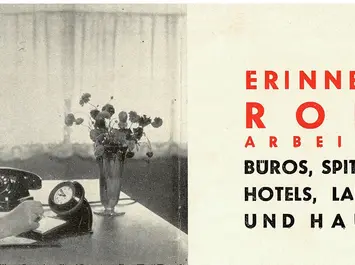
Kommentar schreiben
Kommentar schreiben
Kommentare
Keine Kommentare