
Titelblatt des „Kuckuck“ vom 26. März 1933 (Ausschnitt): Ein Polizist steht vor dem abgeriegelten Parlamentsgebäude Wache. ANNO/ÖNB
Hauptinhalt
Wie man eine Demokratie demontiert: Erster Schritt
„Dreht euch nicht um, die Diktatur geht um“
Während der Sitzung des Nationalrates am 4. März 1933 legte Karl Renner sein Amt als Nationalratspräsident zurück, da „ein großer Teil des Hauses den Entscheidungen des Präsidiums widerspricht.“ Es ging um zwei offensichtlich verwechselte Stimmzettel und die Frage, ob die Abstimmung gültig oder ungültig sei. Der Christlichsoziale Rudolf Ramek und der Großdeutsche Sepp Straffner folgten als zweiter und dritter Präsident mit ihren Rücktritten, die Sitzung endete ohne formalen Schlussakt.
Diese Rücktritte wurden am folgenden Tag in den Zeitungen – auch in den regierungsnahen – als Geschäftsordnungspanne kommentiert, die zu beheben sei. „Es ist nun Sache der maßgebenden Parteiführer und des Verfassungsdienstes, die Lösung aus der schwierigen Frage, was nun zu geschehen habe, zu finden“, schrieb etwa die Reichspost. Am 6. März standen die Schlagzeilen der Zeitungen im Bann der – schon im Zeichen von massiver Repression und Terror stehenden – Reichstagswahl in Deutschland, mit der die NSDAP ihre Macht festigen sollte.
Am 7. März wurde offenbar, dass Bundeskanzler Dollfuß entschlossen war, die Situation zu nützen, um das Parlament auszuschalten. Zwei grundlegend gegen die demokratische, politische Öffentlichkeit gerichtete Maßnahmen traten an diesem Tag in Kraft: ein Versammlungsverbot und die Wiedereinführung der Zensur. Die Zensur wurde per Notverordnung, basierend auf dem Kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetz von 1917 eingeführt. Die Ministerratsprotokolle zeigen ganz klar, dass sich die Regierung der Verfassungswidrigkeit ihres Handelns bewusst war und nicht an einem rechtsstaatlichen Vorgehen, sondern bloß an einer Scheinlegalität ihrer Maßnahmen interessiert war. Ausgearbeitet hatte das Notverordnungsregime – bis zum Februar 1934 sollten mehr als 400 Notverordnungen folgen – Robert Hecht, Sektionschef im Verteidigungsministerium. „Gegen die Obstruktion des versammelten Nationalrates bleibt aber die Regierung weiter wehrlos“, schrieb er in einem Zeitungskommentar. Deshalb musste die Regierung „von der Verordnungsgewalt, die das kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz vom Jahre 1917 bietet, Gebrauch machen.“
Hecht, der hier seine Geringschätzung von Parlamentarismus und Gewaltentrennung offenbart, entwickelte die Konstruktion des Regierens mittels Notverordnungen. Als Beamter hatte er sich bei der politischen Umfärbung des – aus der sozialdemokratisch dominierten Volkswehr hervorgegangenen – Bundesheeres aus konservativer Sicht große Verdienste erworben. Dollfuß zog ihn von Beginn seiner Regierungszeit an als wichtigsten juristischen Berater heran.
Hecht war auch an der Formulierung der austrofaschistischen Maiverfassung von 1934 beteiligt. Vermutlich stammt der tendenziöse Begriff der „Selbstausschaltung des Parlaments“, den Dollfuß als Rechtfertigung seiner Politik einsetzte, ebenfalls von Hecht. Wie sachlich unbegründet dieser Begriff war, zeigte sich am deutlichsten am 15. März: Der dritte Präsident des Nationalrates Sepp Straffner hatte seinen Rücktritt widerrufen und den Nationalrat zur Fortsetzung der nicht geschlossenen Sitzung einberufen. Die oppositionellen Abgeordneten wollten dieser Einberufung Folge leisten, wurden aber von der Polizei daran gehindert. Einzelne erreichten das Parlament noch vor der Abriegelung, darunter auch Straffner selbst, der die Sitzung für fortgesetzt und schließlich für ordnungsgemäß beendet erklärte.

Wie widersinnig es war, dem Nationalsozialismus durch die Ausschaltung des Parlaments zu begegnen, wie eine zentrale Legitimationsstrategie des Regimes lautete, sprachen auch zeitgenössische Kommentare aus dem bürgerlichen Lager an. Am 9. März schrieb die an sich der Bundesregierung freundlich gesinnte Neue Freie Presse: Wenn […] man das Parlament nicht gelten läßt, die Abgeordneten mehr oder minder als Belästigung von sich schiebt, muß da nicht erst recht das Hakenkreuz den politischen Gewinn einstreifen? Auf diese Weise findet ja ihre Parlamentsfeindlichkeit die beste Bestätigung. Wie sollten sie dort achten, wo die Regierung und ihre Mehrheitsparteien so wenig Respekt zeigen. […] Dreht euch nicht um, die Diktatur geht um.“

Aus der Christlichsozialen Partei selbst gab es wenig Widerspruch, ein großer Teil hatte ohnehin große Vorbehalte gegenüber der Demokratie, bis hin zur offenen Ablehnung; die demokraktiefreundlicheren Proponenent*innen überzeugte wohl die Angst vor dem Machtverlust. Prominente Ausnahmen waren der Wiener Gemeinderat und rabiate Antisemit Leopold Kunschak und der Wiener Soziologe Ernst Karl Winter. Winter, der sich selbst als katholisch Konservativer bezeichnete, appellierte im März und April 1933 in offenen Briefen an den Bundespräsidenten Wilhelm Miklas, seine Verantwortung als Staatsoberhaupt wahrzunehmen und sich, insbesondere zur Abwehr des Nationalsozialismus, für eine Verständigung zwischen der christlichsozialen und der sozialdemokratischen Partei einzusetzen: „Das erste ist, daß Sie, Herr Bundespräsident, niemand andrer, die volle und ganze historische Verantwortung tragen für das, was bisher geschehen ist und noch weiter geschehen kann, nicht die Bundesregierung, die ausschließlich in dem leeren Raume tätig ist, den Sie ihr offen lassen.“
Winters Appell blieb wirkungslos, Ende März folgte mit dem Verbot des Republikanischen Schutzbundes ein direkter Schlag gegen die Sozialdemokratie. Der Wiener Bürgermeister Karl Seitz reagierte mit dem Verbot der Heimwehren in Wien, das aber nicht durchgesetzt werden konnte.
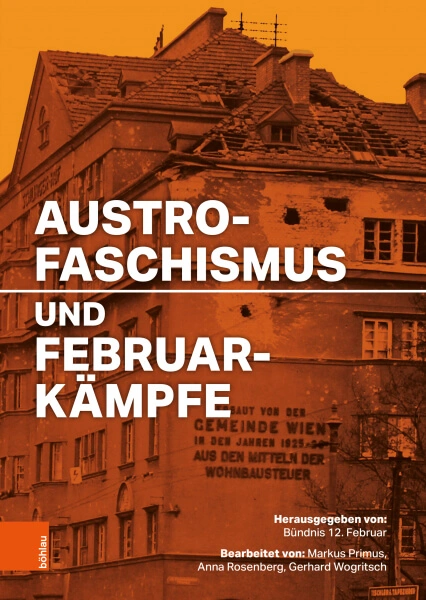
Diese mehrteilige Serie basiert auf dem Beitrag „Der Weg in den Februar“ aus dem soeben erschienenen Buch „Austrofaschismus und Februarkämpfe“ (Böhlau Verlag), herausgegeben vom „Bündnis 12. Februar“. Neben dem einführenden Text von Bernhard Hachleitner und Werner Michael Schwarz versammelt der Band Beiträge von 19 Autor:innen zu historischen, politikwissenschaftlichen, juristischen und kulturellen Aspekten.
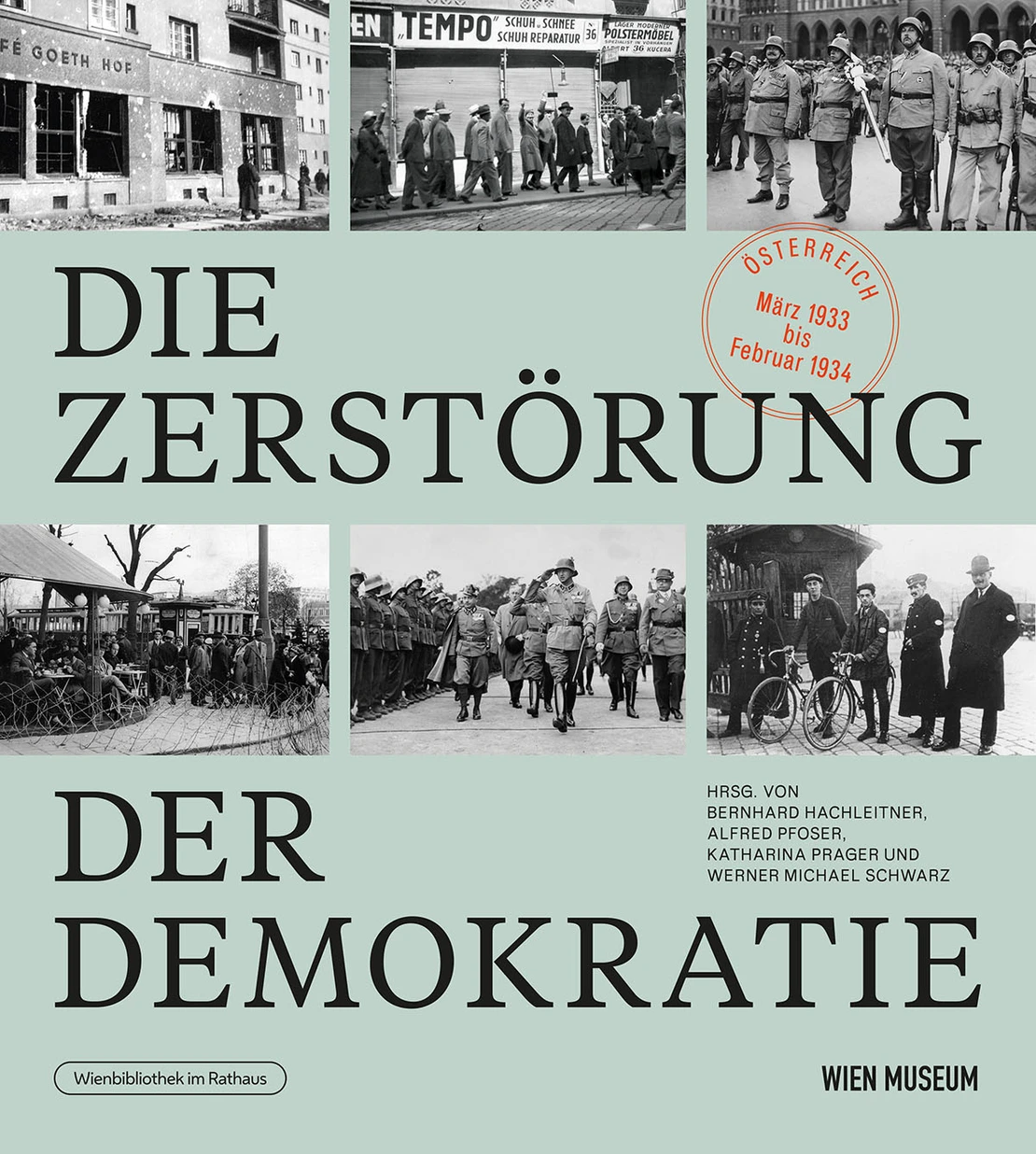
Ein Standardwerk zum Thema ist die Begleitpublikation zur Ausstellung Die Zerstörung der Demokratie. Österreich, März 1933 bis Februar 1934, die von Bernhard Hachleitner, Alfred Pfoser, Katharina Prager und Werner Michael Schwarz herausgegeben wurde (Residenz Verlag) und digital hier frei downzuloaden ist. Einen Auszug aus dem einführenden Text gibt es im Wien Museum Magazin.
Sten. Prot. NR, 125. Sitzung vom 4. März 1933, in: Sten. Prot. NR 1932–1934, 1934, S. 3351–3393, hier S. 3392.
Konrad, Helmut: Die Ausschaltung des Parlaments, in: Hachleitner/Pfoser/Prager/Schwarz: Die Zerstörung der Demokratie, 2023, S. 74–79.
Der Nationalrat ohne Präsidium, in: Reichspost, 5. März 1933, S. 1.
Hecht, Robert: Das Recht der Regierung auf Notverordnungen, in: Allgemeiner Tiroler Anzeiger, 10. April 1933, S. 11f
Neue Freie Presse, 9. März 1933, S. 2.
Die weiteren Teile dieser Serie:




Kommentar schreiben
Kommentar schreiben
Kommentare
Keine Kommentare